[Dieser Artikel erschien aus gleichem Anlass schon vor zwei Jahren. Da sich in diesem Zusammenhang jährlich das gleiche Schauspiel wiederholt, ich dem, was ich damals schrieb nichts hinzuzufügen habe und ich außerdem seitdem viele Leser dazugewonnen habe, denen ich diesen Artikel nicht vorenthalten will, wiederhole ich ihn einfach.]
Zum 65. Jahrestag der Zerstörung Dresdens zeigen die Medien, und weiß Gott nicht nur die, ihre wahre Visage. Wie jedes Jahr.
Da ich heute nicht viel Zeit habe, kann und will ich nicht jeden Aspekt dieser alljährlichen Schande beleuchten. So sei nur kurz angemerkt, dass es den Linken gelungen ist, die ordentlich angemeldete und völlig legale Demonstration rechter Gruppen zu verhindern; dass die Polizei diesen Sieg der politischen Selbstjustiz (angeblich? tatsächlich?) nicht verhindern „konnte“; und dass es eine offene Frage ist, wo das polizeiliche Unvermögen endet und die politisch gewollte klammheimliche Komplizenschaft des Staates mit linken Gewalttätern beginnt.
Ich kommentiere heute nur den Bericht, den ein gewisser Patrick Gensing in tagesschau.de veröffentlicht hat. Also bei einem Medium, das wir alle durch Zwangsabgaben finanzieren:
Neonazis marschieren in Dresden auf
Es versteht sich von selbst: Das sind das alles „Neonazis“, obwohl es bei diesen Trauermärschen genug Teilnehmer gibt, die definitiv keine sind, und obwohl man das auch leicht hätte herausfinden können; keinem Volontär würde man durchgehen lassen, wenn er pauschal alle Teilnehmer einer Demonstration, an der auch Kommunisten beteiligt sind, „Kommunisten“ nennen würde. Wenn es aber um sogenannte oder auch Neonazis (wieso eigentlich nicht „Postnazis“ – wo es doch auch „Postkommunisten“ gibt?) geht, scheint sich soviel Differenzierung zu erübrigen.
Und selbstverständlich „marschieren sie auf“. Hat schon einmal jemand von einem „Aufmarsch“ von Linksextremisten gehört? Das Wort „Aufmarsch“ suggeriert dem Normalbürger: Uniformen, Stiefel, Gleichschritt. Dass dies alles selbst bei Demonstrationen von wirklichen Rechtsextremisten eher die Ausnahme als die Regel ist, interessiert die GEZ-Dichter nicht.
Das Wort „Aufmarsch“ nämlich hat im Zusammenhang mit solchen Demonstrationen schon längst jede inhaltliche Bedeutung eingebüßt, ungefähr so, wie das Wort „Überfall“ zur Bezeichnung des Angriffs auf Polen 1939. Wir haben es hier mit stereotyper Floskelsprache zu tun, deren Gebrauch ideologische Konformität signalisiert. In solcher Sprache äußert sich die Bereitschaft, auf ein eigenes Urteil (das sich zwangsläufig in eigener Wortwahl niederschlagen müsste) zu verzichten und sich einer vorgegebenen Bewertung zu unterwerfen: Aus solchen Texten dampft der Angstschweiß ihrer Verfasser. Wer so schreibt, will einer drohenden Verdächtigung vorbeugen: Keine Differenzierung, man könnte ja der Sympathie mit „Rechts“ verdächtigt werden; kein Satz, der den Leser zum Nachdenken bringen könnte – er könnte ja etwas „Falsches“ denken; keine Objektivität, nicht einmal eine geheuchelte, weil selbst eine bloß vorgetäuschte Objektivität einen als Rechtsabweichler verdächtig machen könnte. Bis in die Formulierungen hinein muss eine Uniformität gewahrt werden, um die der nordkoreanische ZK-Sekretär für Propaganda unsere GEZ-Sender beneiden würde!
Öffentlichen Raum besetzen und braune Propaganda unters Volk bringen, das sind die Ziele rechtsextremer Demonstrationen.
Ei der Donner. Präsenz im öffentlichen Raum zu zeigen und die eigenen Parolen unters Volk zu bringen, gehört nicht etwa zum Wesen und zum Sinn und Zweck politischer Demonstrationen (und ist deshalb durch das Grundgesetz geschützt), sondern zu den besonders üblen Machenschaften von Neonazis, braucht also nicht etwas als Ausübung eines Bürgerrechts respektiert zu werden.
Tausende Neonazis wollen heute in Dresden einen „Trauermarsch“ [Allein für die Anführungszeichen gehört dieser Schreiberling von oben bis unten vollgekotzt!] begehen – und so Deutschlands historische Verbrechen relativieren.
Wieder so eine lächerliche Phrase, die nur den hohlen geistigen Konformismus ihres Urhebers entlarvt: „Deutschlands historische Verbrechen relativieren“, d.h. in Beziehung zur Zerstörung Dresdens setzen – das ist genau das, was die Teilnehmer des Trauermarsches nicht wollen! Nicht sie behaupten, Dresden sei schlimmer als Auschwitz; Auschwitz wird von ihnen gerade nicht thematisiert – wohl aber von der Journaille und der etablierten Politik, die an Dresden – wenn überhaupt – jedenfalls nicht denken kann, ohne ein „Ja. aber Auschwitz…“ anzuhängen.
Erstaunlich nur der Kontrast zwischen dieser Aneinanderreihung von menschenverachtenden Geschmacklosigkeiten und der Sensibilität und dem Verständnis, das dieselben Medien alljährlich im August den japanischen Gedenkfeiern in Hiroshima und Nagasaki entgegenbringen – selbstredend ohne auf das Nanking-Massaker oder ähnliche Verbrechen Japans zu verweisen.
Das ist nicht etwa Schizophrenie: Das ist die notwendige Folge jener geistigen Abhängigkeit vom Nationalsozialismus, in die man sich begibt, wenn man ihn zur Negativfolie für Alles und Jedes macht, weil man „aus der Geschichte gelernt hat“, dass das NS-Regime das absolut Böse war, und dass deshalb nur das genaue Gegenteil dessen, was die Nazis praktiziert haben, moralisch geboten sein kann. Das bedeutet, deutlich: „Aus der Geschichte gelernt“ hat, wer das eigene Volk für lebensunwert und die eigenen Landsleute für Untermenschen hält, deren massenhafte Tötung daher nicht betrauert werden darf, jedenfalls nicht ohne allgegenwärtige Relativierung. Die Antideutschen und ihr „Bomber-Harris, do it again!“ bringen nur auf den Punkt, was die deutschen Müll-Eliten tagein, tagaus über ihre Sender verkünden lassen.
Ausschreitungen werden erwartet.
Und natürlich braucht man nicht zu erwähnen, dass solche Ausschreitungen zwar regelmäßig vorkommen, aber in aller Regel von Linksextremisten ausgehen. So auch diesmal. Ich werde jetzt nicht jeden Satz dieses unsäglichen Geschreibsels auseinandernehmen; nur ein paar, tja, Höhepunkte:
(…)
Zudem wollen sie den Begriff Holocaust umdeuten: Fast genau vor fünf Jahren hatte der NPD-Abgeordnete Jürgen Gansel erstmals vom „Bomben-Holocaust“ gesprochen – im Landtag in Dresden.
Da hat einer schon vergessen, dass der Begriff „Holocaust“ schon in den achtziger Jahren banalisiert worden ist, und zwar von denselben Leuten, die heute vor Pietät kaum laufen können, damals aber keine drei Sätze sagen konnten, ohne vom drohenden „atomaren Holocaust“ zu reden.
Auf vielen Autobahnraststätten drohen Zusammenstöße zwischen Neonazis und Gegendemonstranten, denn auch diese reisen aus dem gesamten Bundesgebiet nach Dresden, um sich den Neonazis in den Weg zu stellen. Bereits im vergangenen Jahr gab es mehrere Angriffe, unter anderem auf einen Bus von Gewerkschaftern aus Hessen.
Behaupten die beteiligten Linken. Als ich selbst einmal einem ähnlichen Fall nachging und beim zuständigen Staatsschutz anfragte, antwortete mir ein leitender Beamter:
„Ihre Recherchen hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes von Aussagen und der tatsächlichen Begebenheiten sind interessant, vor allen Dingen unter den Voraussetzungen, dass endlich … jemand erkennt, dass die „Linken“ auch Unwahrheiten verbreiten. (…) Das Schlimme daran ist nur, dass Leute, die mit diesen Begebenheiten nichts zu tun haben, auf diesen Zug aufspringen und dann teilweise, wie zu DDR-Zeiten eine Stellungnahme(!!) von der Polizei erwarten, wie schlimm sich die „Nazis“ verhalten haben..“
Ob die Redaktion von tagesschau.de wohl auch eine solche Stellungnahme eingeholt hat, bevor sie die Behauptungen von „Kämpfern gegen Rechts“ als „Wahrheiten“ wiederkäute?
(…) Zudem stößt es besonders auf Kritik, dass sich die Neonazis an einem Bahnhof sammeln sollen, von dem die Nationalsozialisten Dresdner Juden in die Vernichtungslager abtransportiert hatten. Politiker von SPD, Grünen und Linkspartei zeigten sich empört. Das Auschwitz-Komitee kritisierte, Dresden sei zu einem Symbol fehlgeschlagener „Gedenk-Kultur“ geworden.
(Bei „Bomber-Harris, do it again!“ hat die Sorge um die „Gedenk-Kultur“ wohl nicht so gebrannt.) Das Argument, wonach Neonazis sich nicht am Bahnhof von Dresden sammeln dürften, läuft seiner Logik nach auf die Forderung hinaus, sie von der Benutzung der Eisenbahn überhaupt auszuschließen.
Ja, so etwas gab schon einmal. Aber wir haben ja gottlob „aus der Geschichte gelernt“.
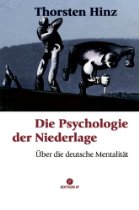





 Kritisierenswert ist einzig und allein, dass man nicht endlich Nägel mit Köpfen macht und das Eiserne Kreuz wiedereinführt. Das Eiserne Kreuz als Emblem der Bundeswehr zu verwenden, aber nicht als Orden; stattdessen Orden wie das Ehrenkreuz zu verwenden, die irgendwie an das Eiserne Kreuz erinnern, ohne eines zu sein: Das ist genau dieselbe Art von Halbherzigkeit und Inkonsequenz, die auch aus der Reduzierung des Deutschlandliedes auf seine dritte Strophe spricht. Nichts Halbes und nichts Ganzes!
Kritisierenswert ist einzig und allein, dass man nicht endlich Nägel mit Köpfen macht und das Eiserne Kreuz wiedereinführt. Das Eiserne Kreuz als Emblem der Bundeswehr zu verwenden, aber nicht als Orden; stattdessen Orden wie das Ehrenkreuz zu verwenden, die irgendwie an das Eiserne Kreuz erinnern, ohne eines zu sein: Das ist genau dieselbe Art von Halbherzigkeit und Inkonsequenz, die auch aus der Reduzierung des Deutschlandliedes auf seine dritte Strophe spricht. Nichts Halbes und nichts Ganzes!