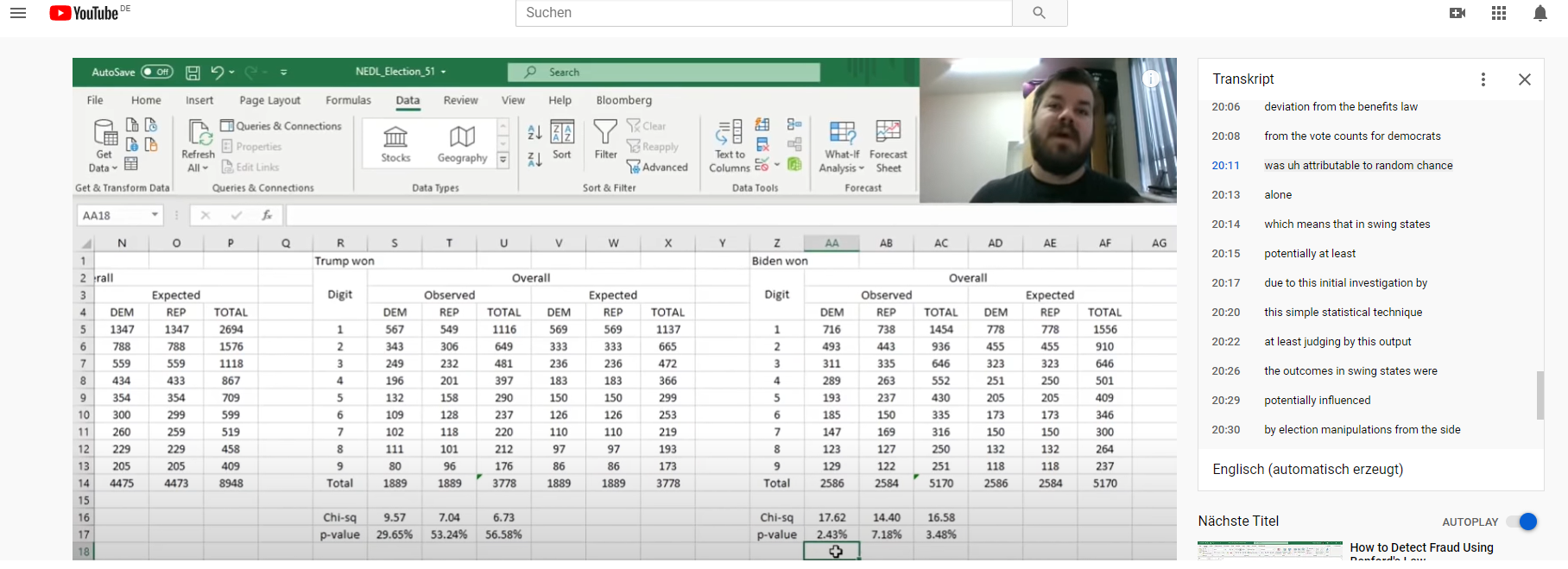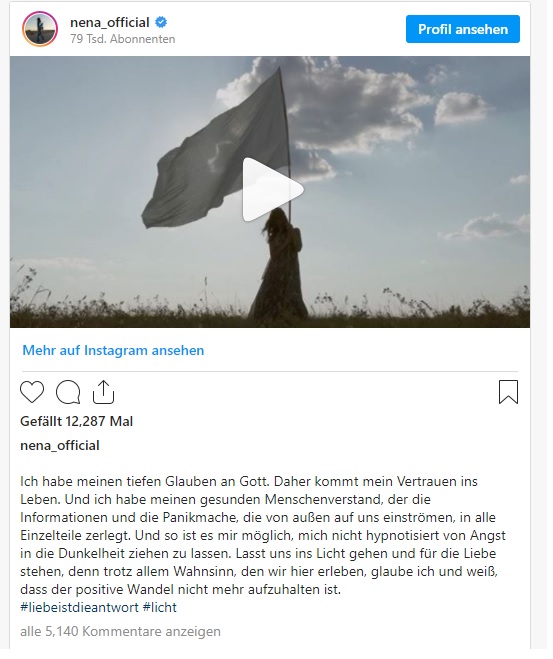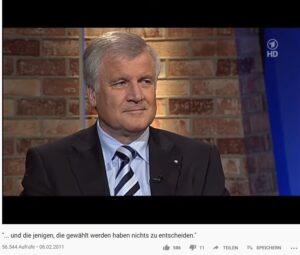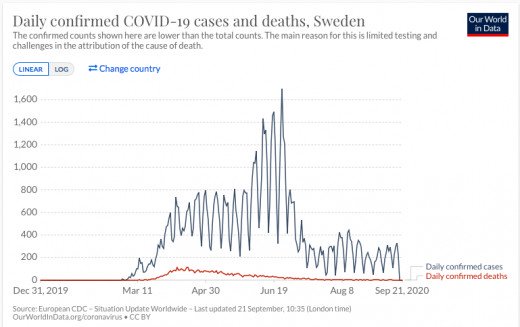Medienkritik
Der Deutsche Buchpreis 2022 …
… geht an einen Roman, dessen Autor uns bei Wikipedia als „nichtbinäre schweizerische Person“ vorgestellt wird, sein Geburtsjahr mit „2666“ angibt und sich bei der Preisverleihung öffentlich die Haare abschneidet, um gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran zu protestieren.
(Ach, möchte man sagen, es gibt wieder Frauen? Dann sollte man vielleicht aufhören, J.K. Rowling dafür zu verteufeln, dass sie sich weigert, von „menstruierenden Menschen“ zu sprechen.)
Der Deutsche Buchpreis möchte die Aufmerksamkeit „auf die Vielschichtigkeit der deutschsprachigen Literatur lenken“, sagte Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, bei der Preisverleihung: „eine Einladung, die Grenzen der eigenen Wahrnehmung zu erweitern. Bestenfalls holen wir uns damit gegenseitig aus unseren Filterblasen heraus …“
Nein, das ist keine Satire: Die merken wirklich nicht, dass ein solcher Roman und ein solcher Autor unfreiwillige Karikaturen just der Filterblase sind, in der der ganze Medienbetrieb schwebt.
Bei so viel ideologischer Eintracht des Autors, des Verlages, der Preisjury und der Medien käme der Roman sicherlich auch ganz ohne Text aus. Aber – Überraschung: Er hat sogar einen! Der Verlag Dumont schreibt:
»Die Erzählfigur in ›Blutbuch‹ identifiziert sich weder als Mann noch als Frau. Aufgewachsen in einem schäbigen Schweizer Vorort, lebt sie mittlerweile in Zürich, ist den engen Strukturen der Herkunft entkommen …«
Den Rest können wir uns dann wohl denken.
Ich werde mich selbstverständlich hüten, Bücher zu rezensieren, die ich nicht gelesen habe. Aber bei derart penetrantem „Virtue Signalling“ aller Beteiligten drängt sich der Verdacht auf, dass hier nicht die literarische Qualität des Werks, sondern seine Tendenz ausgezeichnet wird, und dass der schrille Habitus des Autors (pardon: der nichtmenstruierenden Schreibenden) über Mängel an anderer Stelle hinweghelfen soll.
Und die Frauen im Iran? Die werden bestimmt entzückt sein, wenn das iranische Staatsfernsehen die Bilder der Preisverleihung zeigt – und zwar in Dauerschleife –, verbunden einer ausführlichen Würdigung von Autor und Werk und der Frage:
„Dahin hat der Westen es gebracht. Wollt ihr so etwas auch bei uns?“
Zur Zerstörung der Nordstream-Pipelines und dem Medien-Narrativ
Die deutschen Agitpropmedien führen einen Eiertanz auf, den man komisch finden könnte, wenn der Anlass nicht so ernst wäre. Wie schafft man es, ein Interesse Russlands an der Zerstörung der eigenen Pipelines zu konstruieren?
Für diejenigen, denen man es eigens sagen muss: Wenn Russland „Gas als Waffe“ einsetzen wollte, dann wäre die Sabotage der Pipelines das Dümmste, was Putin zu diesem Zweck hätte einfallen können, denn diese Pipelines kann man nicht mal eben reparieren, und bei längerem Zuwarten überhaupt nicht mehr, weil sie jetzt mit Salzwasser gefüllt sind und korrodieren. Selbst wenn Putin es vorgehabt hätte: Er kann die vermeintliche Gaswaffe nicht einsetzen, weil er uns selbst bei äußerstem Wohlverhalten Europas kein Gas mehr liefern könnte.
Dies ficht unsere Desinformationsmedien selbstredend ebensowenig an wie die Tatsache,
- dass Präsident Biden öffentlich angekündigt hat, die Inbetriebnahme der Pipelines auch gegen den Widerstand der beteiligten Regierungen zu verhindern,
- es angesichts der starken US-Präsenz in der Ostsee kaum möglich gewesen wäre, einen solchen Anschlag praktisch unter den Augen der NATO mit ihren hochmodernen Aufklärungsmitteln zu verüben (Der Text der im Titelbild verlinkten Zeitungsmeldung findet sich hier übrigens auch online)
- und ein Interesse an der Sabotage praktisch jeder hat, der die Inbetriebnahme der Pipelines verhindern will, also praktisch der gesamte westliche Machtkomplex einschließlich seiner Propagandamedien.
Nein, es muss Russland gewesen sein!
Albrecht Müller: „Meinungsmache.“ (Rezension)

Wenn die deutsche Politik jemals eine Wahlkampfparole hervorgebracht hat, die den Adressaten zum Mitdenken aufrief, dann war das der 72er SPD-Slogan „Wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen kämpfen“. Eine ziemlich faire Parole, weil sie den Leser nicht manipuliert: Er wird zum Nachdenken animiert, und das heißt: Er kann sie auch ablehnen.
Dem linken Sozialdemokraten Albrecht Müller, der als Schöpfer dieses Slogans gilt, wird man also zumindest bescheinigen müssen, dass er die Intelligenz seiner Mitmenschen respektiert. Solcher Respekt gerät bei den meinungsbildenden Eliten bekanntlich immer stärker außer Kurs, und Müller hat ein ganzes Buch genau den Methoden gewidmet, mit denen sie dafür sorgen, dass der vielzitierte Mainstream in eine ganz bestimmte Richtung fließt.
[Diese Rezension wurde schon 2010 auf diesem Blog veröffentlicht, aber alles, was ich damals geschrieben habe, wurde seitdem von der Realität sogar übertroffen, und auch Müllers Buch ist aktueller denn je. Die damaligen Kommentare habe ich stehengelassen, ohne aber den Kommentarstrang nochmals zu öffnen. M. K.-H.]
Dabei macht er Erfahrungen, die einem Konservativen merkwürdig vertraut vorkommen, und so mancher Kommentator dieses Blogs wird mit einer Mischung aus Mitgefühl und Schadenfreude Passagen wie diese hier lesen:
„Wenn ich … beschreibe, dass die Leistungsfähigkeit des bisherigen Rentensystems systematisch, bewusst und geplant der Erosion preisgegeben worden ist, um [sic!] an diesem Zerstörungswerk zu verdienen, dann kommt der Angriff mit der Behauptung: ‚Sie sind ein Verschwörungstheoretiker!’“(S.133)
Leider analysiert er nicht die Wirkungsweise gerade des Vorwurfs der „Verschwörungstheorie“; also erlaube ich mir hier einen Exkurs: Wie manchem Leser erinnerlich ist, bin ich höchst kritisch gegenüber Verschwörungstheorien und habe im Einzelfall ausführlich begründet, was ich unter einer Verschwörungstheorie verstehe und warum ich sie für problematisch halte. Wer so argumentiert, erlegt sich selbst die Beweislast auf.
Es greift aber immer mehr um sich, Verschwörungstheorien zu tabuisieren, ohne zu begründen, warum. Auf diesem Wege wird die Ablehnung von Verschwörungstheorien zum bloßen sozialen Vorurteil und das Wort „Verschwörungstheorie“ zum Etikett, das man nahezu beliebigen Meinungen aufpappen kann, die dadurch aus dem seriösen Diskurs ausgegrenzt werden – ähnlich, wie es mit dem Wort „rechtsextrem“ schon geschehen ist. Das Ergebnis ist eine Beweislastumkehr: Wer beweisen will, dass er kein „Verschwörungstheoretiker“ respektive nicht „rechtsextrem“ ist, kann dies nur dadurch tun, dass er sich von allen Meinungen, Personen und Organisationen distanziert, denen das entsprechende Schandmal aufgebrannt wurde. Da die Diffamierung aber nahezu beliebig vorgenommen werden kann, führt diese (wie jede andere) Art von Appeasement keineswegs dazu, die Diffamierer zufriedenzustellen; vielmehr wird die Grenze des gesellschaftlich Tolerablen mit jedem Zugeständnis enger gezogen: Musste man vor dreißig Jahren noch Hakenkreuzfahnen schwenken, um als rechtsextrem eingestuft zu werden, so reicht heute schon der Gebrauch des Wortes „Neger“.
Müller, wie gesagt, interessiert sich dafür weniger. Linke Sozialisten sind zwar aus der Sicht der meinungsbildenden Eliten ebenso Außenseiter wie rechte Konservative, aber sie werden nicht so sehr moralisch diffamiert, eher schon laufen sie Gefahr, als rückständige Sozialromantiker lächerlich gemacht zu werden, die die Zeichen der Zeit – und speziell der Globalisierung – nicht erkannt haben.
Umso bemerkenswerter die Parallelen, die zwischen beiden Arten politischen Denkens bestehen. Vielleicht fallen diese Parallelen einem wie mir besonders ins Auge, der lange Jahre politisch dort stand, wo auch Müller steht, und heute dort ist, wo der rechte Flügel der CDU wäre, wenn es einen solchen noch gäbe. Ich glaube aber, dass die Gemeinsamkeiten von Sozialisten und Konservativen nicht nur meiner speziellen Optik geschuldet, sondern objektiv vorhanden sind:
Einer wie Müller, der den handlungsfähigen Staat, ein breites und tiefes Angebot öffentlicher Dienstleistungen, aktive keynesianische Konjunkturpolitik und eine dichtgeknüpftes soziales Netz will, fasst Gesellschaft offenkundig nicht als eine bloße Masse von Einzelperonen auf, sondern als Solidargemeinschaft. Das ist das Gegenteil von dem, was der neoliberalen Doktrin entspricht, ähnelt aber offenkundig dem klassischen konservativen Programm der Bewahrung von Volk und Familie, das heißt von – Solidaritätsstrukturen!
Diese Programme sind selbstverständlich nicht gleich, aber sie sind miteinander vereinbar, zum Teil sogar voneinander abhängig: Ist Sozialismus schon rein technisch schwer vorstellbar ohne Bezugnahme auf einen Staat, so ist er – als Solidargemeinschaft – erst recht ideell unvorstellbar ohne die Bereitschaft zur wechselseitigen Solidarität im gesellschaftlichen Maßstab. Solche Bereitschaft fällt aber nicht vom Himmel, und sie wird auch nicht vom Sozialstaat erzeugt; vielmehr findet er sie vor! Die Bereitschaft zur materiellen Solidarität setzt die Vorstellung von einem „Wir“ voraus. Zu deutsch: ein Volk.
Freilich wollen die Linken das nicht wahrhaben, weil es sie in ideologische Peinlichkeiten stürzt: Zu den Implikationen dieses Sachverhalts gehört ja unter anderem, dass Sozialismus stets etwas sein muss, das man mit einigem Recht auch „National-Sozialismus“ nennen könnte. Eine Solidargemeinschaft kommt, allein schon um die Gegenseitigkeit zu gewährleisten, ohne die es sinnlos wäre, von „Solidarität“ zu sprechen, gar nicht darum herum zu definieren, wer dazugehört und wer nicht. Aller internationalistischen Rhetorik zum Trotz würde ein Sozialismus, der alle Menschen weltweit beglücken wollte, schnell aufhören zu existieren. Sozialismus wird immer, wie Stalin das nannte, „Sozialismus in einem Lande“ sein.
Aus der Abneigung gegen solche Gedankengänge resultieren bei Sozialisten, auch bei so klugen Köpfen wie Albrecht Müller, ganz bestimmte blinde Flecken: Der Sozialstaat ist zwar in der Tat systematisch von den siebziger Jahren an ideologisch delegitimiert worden, wie er behauptet – wir kommen gleich dazu -, aber zumindest einer der wichtigsten Gründe für seinen Legitimitätsverlust hat nichts mit Ideologie, PR oder Propaganda zu tun, sondern schlicht mit der Masseneinwanderung von Menschen, bei denen von vornherein feststand, dass sie den Sozialstaat in erheblichem Maße in Anspruch nehmen würden, und zwar ohne Gegenleistung – auch ohne diejenigen Gegenleistungen an Loyalität gegenüber dem Gemeinwesen, zu denen auch ein materiell armer Mensch fähig ist. Ein solcher Sozialstaat hat mit Solidarität nichts zu tun, und niemand muss sich wundern, dass die, die ein solches System mit ihrer Arbeit finanzieren sollen, sich davon abwenden.
Ein ganz ähnlicher blinder Fleck zeigt sich beim Thema „Demographie“: Müller behauptet, Deutschlands demographische Krise (mit der der langsame Abschied vom Umlageverfahren in der gesetzlichen Rentenversicherung begründet wird), werde weit übertrieben, da unser Land nach bisherigen Prognosen auch 2050 noch 75 Milionen Einwohner haben werde. Dass dieser Wert nur durch massive Einwanderung erreicht werden kann, und dass die Masse der Einwanderer nach allen bisherigen Erfahrungen gering qualifiziert und wenig integrationsbereit sein wird, ja dass sogar zu bezweifeln ist, ob Deutschland überhaupt noch regierbar sein wird, wenn sein Staatsvolk – zumindest bei den wirtschaftlich aktiven Bürgern – eine Minderheit im eigenen Land ist: Das sind Themen, die bei Müller nicht zur Sprache kommen. Er verschweigt sie nicht etwa, er hat sie einfach nicht auf dem Radarschirm.
Nun aber genug von den blinden Flecken, ich schreibe diese Rezension ja nicht zum Zwecke kleinlicher Beckmesserei!
Gemeinsam ist Sozialisten und Konservativen die Erfahrung, dass sie selbst ihre Positionen ausführlich begründen müssen, um sich verständlich zu machen, während etablierte „Wahrheiten“ zu Begriffen geronnen sind, die man schon deshalb Schlagworte nennen darf, weil sie nicht dazu da sind, Gegner argumentativ zu widerlegen, sondern ihren Widerspruch niederzuknüppeln. Ein Sozialist, der darauf hinweist, dass neoliberale Zauberworte wie „Flexibilität“ oder „Wettbewerb“ durchaus nicht immer für etwas Positives stehen müssen, bekommt ähnliche Probleme, sich verständlich zu machen wie ein Konservativer, der darauf besteht, dass Feindschaft gegen das eigene Volk hundertmal schlimmer ist als „Fremdenfeindlichkeit“. Eine Ideologie, die sich auf Schlagworte beschränken kann, ist offenkundig gesellschaftlich dominant.
Erleichtert wird diese Dominanz dadurch, dass sowohl Sozialisten als auch Konservative dazu tendieren, je verschiedene Teile dieses neoliberalen Paradigmas für richtig zu halten: die Linken also die Tendenz zu Entgrenzung und Internationalisierung – obwohl das, wie gezeigt, für Traditionssozialisten an sich inkonsequent ist -, die Rechten die Abneigung gegen das, was sie für linken Sozialklimbim halten.
Letzteres ist fast noch erstaunlicher als die linke Inkonsequenz: Es war ein Konservativer – Bismarck -, der den Grundstein für den deutschen Sozialstaat gelegt hat, und wenn Deutschland auch in den vergangenen hundert Jahren praktisch jede Regierungsform erlebt hat, die überhaupt zur Auswahl stand: Alle Regime haben den Sozialstaat unterstützt und, soweit möglich, ausgebaut. Und auch heute noch gibt es eine deutliche Mehrheit für die Idee, dass eine moderne Gesellschaft sich auch durch materielle Solidarität auszeichnen sollte.
(Wie lange es diese Mehrheit unter dem Druck der Masseneinwanderung noch gibt, steht freilich auf einem anderen Blatt: Dass diese Einwanderung die Idee des Sozialstaats schlechthin in Frage stellt, dürfte aus der Sicht der neoloiberalen Eliten nicht der geringste ihrer Vorzüge sein.)
Wir können daraus schließen, dass die Idee sozialer Solidarität zur Selbstbeschreibung des deutschen Volkes, sprich: zu seiner nationalen Identität gehört. Selbstredend müssen auch Konservative nicht vor Allem und Jedem auf die Knie fallen, was zu dieser Identität gehört, aber die Selbstverständlichkeit, mit der die sozialstaatsfeindliche neoliberale Wirtschaftsideologie von vielen Konservativen akzeptiert wird, erstaunt schon deshalb, weil sie damit ja zugleich die ihr zugrundeliegende Meta-Ideologie schlucken, wonach es überhaupt so etwas wie ein universell anwendbares Wirtschafts-(und Politik- und Gesellschafts-)modell geben könne oder gar müsse. Konservatismus, wenn er mehr sein soll als bloß geistige Bequemlichkeit, müsste aber gerade diese Prämisse des Globalismus prinzipiell anfechten und auf dem Eigenwert und der Eigenlogik unterschiedlicher gewachsener Kulturen beharren. Tut er es nicht, hat er bereits die Waffen gestreckt.
Die entscheidende Frage ist nun: Wie kommt die neoliberale Ideologie eigentlich in die Köpfe? Um dies zu erläutern, untersucht Albrecht Müller die taktischen Mittel der Meinungsmache, dann die strategischen Zusammenhänge, in denen sie eingesetzt werden, und benennt dabei auch einige wichtige Akteure. Die taktischen Mittel, mit denen Ideologie gestreut wird, sind:
Wiederholung: „Wenn alle maßgeblichen Personen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien erzählen, die Globalisierung sei ein völlig neues Phänomen …, was soll die Mehrheit der Bevölkerung dann glauben?“ (S.127) Wenn dies nicht bloß einmal geschieht, sondern über Jahre hinweg fortgesetzt wird, dann gehört das, was da verkündet wird, unweigerlich irgendwann zu den Hintergrundannahmen des gesellschaftlichen Diskurses.
Dieselbe Botschaft aus unterschiedlichen Ecken verkünden: „Wenn der frühere Bahnchef Hartmut Mehdorn und der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn 
Werner Müller, der zuvor unter Gerhard Schröder Bundeswirtschaftsminister war …, wenn diese beiden das Gleiche sagen wie Norbert Hansen, der … Vorsitzende der größten Eisenbahnergewerkschaft …, dann muss der Börsengang ja gut sein für die Bahn.“ (S.129) Und, möchte man von einem rechten Standpunkt hinzufügen, wenn die CDU sich für Masseneinwanderung stark macht und uns, wie die Grünen, etwas von der damit verbundenen „Bereicherung“ vorschwärmt; wenn obendrein Heerscharen von Wissenschaftlern die vermeintlichen Vorzüge der „Diversität“ anpreisen, dann können nur ungewöhnlich selbstbewusste Menschen sich vorstellen, dass die Alle Unrecht haben sollen.
Vokabeln verwenden, die Urteile und Wertungen beinhalten: „Flexibilität“ klingt doch immer gut, nicht wahr, erst recht „Toleranz“? Müller selbst führt das Wort „Reform“ als Beispiel für einen positiv besetzten Begriff an, der dann umgedeutet wird (in „Reformen“ zugunsten der Oberschicht). (Dass die Umdeutung zentraler politischer Begriffe auch zu den bevorzugten Strategien der EU zu Gesellschaftstransformation gehört, dazu empfehle ich nochmals den Aufsatz von Christian Zeitz)
Einen gruppenspezifischen Jargon sprechen: Ein solcher reduziert ganze Ideologien auf Schlagworte, die für jeweils bestimmte Gruppen gelten und diese Gruppen definieren. Wer ihn nicht spricht – und damit anzeigt, dass er die gruppenspezifische Ideologie nicht teilt – ist draußen. In Kreisen, in denen von „den Märkten“ die Rede ist, sollte man sich Ausdrücke wie „Solidarität“ oder „Gerechtigkeit“ ebenso verkneifen wie „Vaterland“ oder „Abendland“.
Affirmativ auftreten: Menschen neigen dazu, zu glauben, was ihnen erzählt wird. Eine Richtigkeitskontrolle findet höchstens intuitiv statt: Steht der Sprecher hinter dem, was er sagt? Wenn er das vortäuschen kann, glaubt man ihm. Müller zitiert den damaligen Finanzminister Steinbrück: „Schließlich steht außer Zweifel, dass wir einen starken und wettbewerbsfähigen Finanzplatz Deutschland brauchen.“ (S.130) Wer wird sich da schon die Blöße geben, der Hinterwäldler zu sein, der bezweifelt, was doch „außer Zweifel steht“?
Immer im Angriff bleiben: Der Kritiker kann gar nicht Recht haben, und vor allem darf er es nicht. Er kann dumm (links) oder bösartig (rechts) sein; tertium non datur. Ein Rezept, das schon die Nazis praktiziert haben, ebenso wie das folgende:
Keine Diskussionen zulassen: TINA (There is no alternative) bedeutet, die eigentliche Ideologie wird aus jeder Diskussion herausgehalten; so sind die Schlussfolgerungen aus ihr dann tatsächlich ohne Alternative.
Pars pro toto: Einen gesellschaftlichen Missstand dadurch verschwinden lassen (oder dadurch herbeireden), dass man Einzelfälle willkürlich verallgemeinert.
Übertreibung: Wird gerne zur Diffamierung Andersdenkender eingesetzt.
Botschaft B senden, um A zu transportieren: Die explizite Aussage enthält eine Implikation, die als solche unausgesprochen bleibt, aber gerade dadurch umso unauffälliger, d.h. ohne den Filter der kritischen Nachprüfung in die Köpfe gelangt. „Wir verstehen nicht, warum die Bundeskanzlerin und der Bundesfinanzminister die Banken flehentlich darum bitten, doch endlich unsere 480 Rettungs-Milliarden zu nehmen. Diese Botschaft B wird verständlich, wenn wir die Botschaft A bedenken: Die Banken erweisen uns einen Gefallen, sie erlauben uns gnädig, ihnen unser Geld zu geben, statt ihnen den Staatsanwalt ins Haus zu schicken, was angesichts des millionenfachen Betrugs gerechtfertigt wäre.“ (S.140)
Konflikt: Der inszenierte Konflikt beschäftigt das Publikum so sehr, dass seine Protagonisten die Agenda bestimmen. Müller führt den „Konflikt“ zwischen Schröder und Lafontaine im Vorfeld der Bundestagswahl 1998 an, der entscheidend zum Wahlsieg der SPD beigetragen hat. Auf einer höheren Ebene war die gesamte Zeit des Kalten Krieges so sehr von dem Gegensatz von Liberalismus und Sozialismus, zweier linker Ideologien, beherrscht, dass der Konservatismus aus dem Weltbild des Normalbürgers hinausdefiniert wurde (übrigens so sehr, dass auch Albrecht Müller mit einer gewissen nervtötenden Penetranz „rechtskonservativ“ sagt, wenn er „extrem neoliberal“ meint – das tut dann schon richtig weh.)
Verschweigen: Welcher Ideologie die veröffentlichte Meinung folgt, lässt sich daran ablesen, mit welchen Themen sie sich nicht beschäftigt und welche Wahrheiten sie nicht ausspricht. Beispiele erübrigen sich – es gibt sie, vom linken wie vom rechten Standpunkt, zuhauf.
Seit den siebziger Jahren wird massive Propaganda zugunsten der Privatisierung bisher öffentlich erbrachter Dienstleistungen gemacht, werden öffentliche Dienstleistungssysteme bewusst kaputtgespart, um ihre dann notwendig geringere Leistung einem angeblichen „Sozialismus“ in die Schuhe zu schieben, so lange, bis sie tatsächlich privatisiert werden (oder, wo das nicht ohne weiteres möglich ist, wie bei den Universitäten, sie strukturell Privatunternehmen weitgehend angelichen werden). Müller weist, m.E. zu Recht, darauf hin, dass die damit erzielten Verbesserungen bestenfalls zweifelhaft waren, die Schäden aber genau dort eingetreten sind, wo sie zu erwarten waren: bei der Verlässlichkeit, der Nachhaltigkeit, der Langfristperspektive und der Zugangsgleichheit. Das fängt bei Kommunikationsdienstleistungen an, setzt sich fort im Bildungsbereich und im Verkehrswesen und hört bei den Medien noch lange nicht auf. Ich werde diesen Aspekt hier nicht vertiefen (und verweise auf das Buch), weil es mir hier ja nicht darum geht, wo die Neoliberalen Recht oder Unrecht haben, sondern wie sie ihre Ideologie unter die Leute bringen.
In diesem Zusammenhang spielt zum Beispiel die Kommerzialisierung der Medien eine Rolle: zum einen durch die Einführung des kommerziellen Fernsehens in den achtziger Jahren, zum anderen dadurch, dass auch die gedruckten Medien mehr und mehr dem Diktat des Shareholder Value unterworfen werden.
Letzteres – dass also kapitalistische Unternehmen naturgemäß auf Deubel komm raus maximalen Gewinn erwirtschaften müssten – wird zwar vielfach für selbstverständlich gehalten, liegt aber durchaus nicht in der Natur der Sache. In der Natur der Sache liegt lediglich, dass solche Unternehmen um jeden Preis die Pleite vermeiden müssen. Wer freilich Gewinnmaximierung anstrebt, wird im Medienbereich dasselbe tun wie in anderen Branchen, nämlich Stellen streichen und auslagern, Löhne und Honorare drücken, zusätzliche Einnahmequellen erschließen. Für die Redakteure, die unter solchem Druck produzieren müssen, ist es ein zweifelhafter Glücksfall, dass es zu jedem Thema vier oder fünf sogenannte oder auch Experten gibt, auf die man arbeitssparend zurückgreifen kann, und die, weil sie normalerweise alle dieselbe Meinung vertreten, keine irritierenden Dissonanzen aufkommen lassen, stattdessen suggerieren, es könne ohnehin bloß eine vernünftigerweise vertretbare Meinung geben, nämlich ihre eigene.
Und dabei ist das noch eine relativ saubere Form von Journalismus, verglichen mit dem Einsatz von Fertigprodukten aus PR-Abteilungen. Publizistische Unabhängigkeit, auch früher schon wegen der Abhängigkeit von Werbekunden ein heikles Thema, wird in dem Maße zur Fiktion, wie man sich von kapitalstarken PR-Anbietern kaufen lässt: Sich die Spalten und Sendeplätze füllen zu lassen und dafür noch Geld zu kassieren – das ist journalistisch das Allerletzte, aber kommerziell der Königsweg.
Und das betrifft nicht nur private Medien: Im „redaktionellen“ Teil der GEZ-Sender spottet das Maß an Werbung, die man längst nicht mehr „Schleichwerbung“ nennen kann, inzwischen jeder Beschreibung! Dass die Orientierung am kommerziellen Erfolg das Ergebnis einer ideologischen Gehirnwäsche ist, die mit ökonomischen Notwendigkeiten nichts zu tun hat, liegt gerade bei diesen Sendern auf der Hand.
Ganz ähnlich sieht es bei den Universitäten aus. Dort hat die Gehirnwäsche schon so weit gefruchtet, dass kaum noch einem aufzufallen scheint, dass der vielgepriesene „Wettbewerb der Universitäten um Drittmittel“ (der Wirtschaft und des Staates) auf nichts anderes hinausläuft als darauf, die wissenschaftliche Unabhängigkeit an den Meistbietenden zu verhökern. Im naturwissenschaftlich-technischen Bereich lässt sich vielleicht noch darüber diskutieren, ob die dadurch möglicherweise erzielbare Orientierung an der praktischen Anwendung auch ihr Gutes hat. Bei den Geistes- und Sozialwissenschaften bedeutet es die Verwandlung von Universitäten in Ideologiefabriken. Wenn zudem noch der Turbo-Master gefordert wird (von Studenten, die bereits das Turbo-Abitur hinter sich haben), dann ist das erwartbare Ergebnis, dass die Bereitschaft und Fähigkeit zu ideologiekritischem Denken (von welchem politischen Ausgangspunkt auch immer) nicht mehr entwickelt wird. Und sie sollen ja auch gar nicht entwickelt werden. (Und nochmal: Neoliberale und linksliberale Ideologien ergänzen einander, sie widersprechen einander nicht! Allenfalls setzen sie unterschiedliche Akzente. Weswegen der Einwand, die Unis seien doch in der Hand der Linken, am springenden Punkt vorbeigeht.)
Kommerzialisierung wirkt also in diesen Bereichen selbstverstärkend: Kommerzialisierte, gewinnmaximierte Medien und Universitäten bringen wie von selbst genau die Ideologie hervor, die ihre eigenen Binnenstrukturen legitimiert; zugleich verlieren sie in dem Maße an Autonomie, wie die Orientierung an nichtwissenschaftlichen bzw. nichtpublizistischen Kriterien zunimmt. Das soziologische Standardmodell einer funktional differenzierten und sich immer weiter differenzierenden Gesellschaft stößt bei der Beschreibung eines solchen Sachverhalts nicht nur an Grenzen: Es führt sogar in die Irre, weil es einen Prozess der systematischen Ent-differenzierung verschleiert, bei dem verschiedene Teilsysteme den Maßgaben derselben leitenden Ideologie unterworfen werden.
Wie aber konnte die neoliberale Ideologie so dominant werden, und wer hat die Kampagnen angeschoben, die eine so nachhaltige ideologische Wirkung gezeitigt haben?
Leider bleibt Müller in seiner Darstellung ganz auf Deutschland fixiert, obwohl die Durchsetzung des neoliberalen Paradigmas ein Prozess war, den man seit den sechziger Jahren in der gesamten westlichen Welt beobachten konnte. Müller erwähnt zwar die „Chicago Boys“, also die Gruppe von Ökonomen um Milton Friedman, aber eine umfassende Darstellung strebt er nicht an.
Umso interessanter ist das, was er über die Rolle der Bertelsmann-Stiftung schreibt, die seit ihrer Gründung in den siebziger Jahren das neoliberale Paradigma verficht. Natürlich ist sie nicht der einzige Akteur auf diesem Gebiet: Wirtschaftsnahe Institute und Lobbyorganisationen mit vergleichbarer Agenda gibt es zuhauf, aber die Bertelsmann-Stiftung liefert – gerade für Politiker als Abnehmer – ganze Fertigpakete: nicht nur eine Ideologie, auch die dazu passenden wissenschaftlichen Studien; nicht nur Studien, sondern auch Handlungsempfehlungen; und zu den Empfehlungen gleich die Strategien zu ihrer Umsetzung; verbunden mit publizistischer Unterstützung für diejenigen Politiker, die sich an diese Empfehlungen des Hauses Bertelsmann halten, das zugleich Eigentümer eines der größten Medienkonzerne der Welt ist. Politiker, die sich darauf konzentrieren wollen, an der Macht zu bleiben, und die zu diesem Zwecke auch politische Inhalte benötigen – als notwendiges Übel sozusagen –, werden bei Bertelsmann zweifellos erstklassig bedient.
Der inzwischen verstorbene Bertelsmann-Gründer Reinhard Mohn hat hier eine Struktur geschaffen, die ganz auf die Verbreitung und gesellschaftliche Durchsetzung seiner Ideologie programmiert ist. Ich weiß nicht, und Müller schreibt nichts darüber, aber ich vermute, dass Springer, Murdoch und Berlusconi in ähnlicher Weise für ihr Nachleben vorgesorgt haben. In jedem Fall ist es auffällig, wie gering die Anzahl der Großakteure ist, die hier eine Rolle spielen.
Wenn man mit so viel Medienmacht erst einmal eine ganz bestimmte Sicht der Welt als dominant etabliert hat, kommt es wie von alleine zur Selbstgleichschaltung der nicht konzerngebundenen Medien und von Politikern, die eigentlich für die Unterstützung einer anderen, z.B. linken oder konservativen Agenda gewählt wurden. Wer möchte sich schon nachsagen lassen, die Zeichen der Zeit nicht erkannt zu haben. Wenn die Bejahung einer bestimmten Ideologie – sprich: die Bereitschaft und Fähigkeit, mit einer gewissen urbanen Lässigkeit alles abzulehnen, was der Normalbürger für selbstverständlich hält – über die Zugehörigkeit zur Elite entscheidet, dann werden anderslautende Prinzipien schnell zu etwas Lästigem, das man höchstens noch zur Täuschung der Wähler benötigt.
(Ob man wirklich dazugehört, steht freilich auf einem anderen Blatt. Gerhard Schröder jedenfalls erfuhr erst im Frühjahr 2005 durch den plötzlichen Schwenk jener Blätter, die ihn bis dahin unterstützt hatten, dass er bloß der nützliche Idiot gewesen war, der den Boden für eine neoliberale Reformpolitik hatte bereiten sollen. Nachdem das erledigt war, war er plötzlich jener Mohr, der seine Arbeit getan hatte. Der Mohr konnte gehen.)
Und man glaube nicht, das diese Form von Korruption durch Eitelkeit nur auf der Linken funktioniert. Der linke Politiker, der sich nicht dabei erwischen lassen möchte, von Klasseninteressen oder Solidarität zu sprechen, weil das rückständig wäre, findet seine rechten Gegenstücke in gewissen Leuten, die sich nicht dabei erwischen lassen möchten, noch an die Existenz von Völkern zu glauben, und die uns deshalb in der „Sezession“ oder der „Jungen Freiheit“ die neoliberale „Wahrheit“ unterzujubeln versuchen, dass Masseneinwanderung unvermeidlich sei.
Ich bin mit Müller selbstredend nicht in jedem Punkt einverstanden; mir scheint auch, dass er die Möglichkeiten eines spezifisch sozialistischen Politikansatzes deutlich überschätzt – aber wer weiß? Ich bin im Gegensatz zu ihm kein Makroökonom, und vielleicht bin ich selbst ein Opfer neoliberaler Meinungsmache? Ich finde jedenfalls, man sollte seine eigenen Meinungen von Zeit zu Zeit darauf abklopfen, ob sie auch wirklich die eigenen sind. Womöglich vertritt man sie nur, weil „Alle“ sie vertreten, insbesondere die „Eliten“, und die müssen es ja wissen, nicht wahr?
Müller empfiehlt, wie ich selbst auch, die Übermacht der Meinungsmacher durch Nutzung des Netzes zu konterkarieren, und unterhält zu diesem Zweck die NachDenkSeiten. Sein Buch ist ungeachtet einiger Schwächen gerade für Konservative lesenswert: weil man manche Sachverhalte klarer sieht, wenn sie einmal nicht anhand der eigenen Lieblingsthemen erläutert werden; und weil man gerade an der Auseinandersetzung mit sozialistischen Positionen merken kann, wie sehr man unter Umständen selber auf der Basis von neoliberalen Annahmen argumentiert, die man nicht wirklich kritisch überprüft hat.
Pussy Riot und die deutsche Ochlokratie
Vor zehn Jahren, am 17. August 2012, wurden Mitglieder der Emanzen-Punkband Pussy Riot von einem Moskauer Gericht wegen „Rowdytums aus religiösem Hass“ erstinstanzlich zu zwei Jahren Haft verurteilt: Die Frauen waren im Februar 2012 in das zentrale Gotteshaus der Russisch-Orthodoxen Kirche, die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, eingedrungen, und hatten dort als Kunst getarnte Parolen skandiert, unter anderem „Scheiße, Scheiße, Gottesscheiße“ und „Mutter Gottes, Jungfrau, werde Feministin“.
Das politisch-mediale deutsche Establishment, das damals schon bei jeder Gelegenheit gegen Russland hetzte, schäumte vor Wut über das Urteil. Ich kommentierte damals:
Alle deutschen Politiker und Medienschaffenden sind sich einig: Das Urteil gegen die Punkband „Pussy Riot“ sei „rechtsstaatswidrig“, „politisch motiviert“ und „Justizwillkür“, die „die Menschenrechte missachte“; Russland habe damit gezeigt, dass es weder ein Rechtsstaat noch eine Demokratie sei. Irgendwelchen Widerspruch gegen diese Diagnose kann man im Mainstream mit der Lupe suchen.
Medienkampagnen sind in Deutschland an der Tagesordnung, und oft genug haben sie eine erkennbare politische Funktion, wie etwa die Hetzkampagne gegen das syrische Regime, die offenkundig der propagandistischen Kriegsvorbereitung dient, oder die Kampagne „gegen Rechts“, die sich an den angeblichen NSU-Morden entzündet hat, und bei der all den „investigativen“ Journalisten nicht auffällt oder auffallen darf, dass die Nazimörderstory, die die Sicherheitsbehörden uns in diesem Zusammenhang auftischen, durch kaum einen greifbaren Beweis untermauert ist, dafür aber von Ungereimtheiten nur so strotzt.
Die Kampagne für „Pussy Riot“ ist dadurch bemerkenswert, dass ein unmittelbar politisches Motiv nicht erkennbar ist, und dass ein Journalist, der die Musikerinnen kritisieren oder Verständnis für das Urteil äußern würde, dadurch nicht die Grenzen der Political Correctness überschreiten oder seine Karriere riskieren würde. Die Selbstgleichschaltung der Medien im Falle „Pussy Riot“ geschieht offenbar aus Überzeugung und wirft gerade dadurch ein Licht auf die Art der Überzeugungen in den Köpfen jener Menschen, die den politisch-medialen Komplex bilden. Es handelt sich um einen jener Vorgänge, die blitzartig beleuchten, von welcher Art Menschen wir regiert und (des-)informiert werden, und man ist stets aufs Neue verblüfft, dass diesen Menschen offenbar nicht klar ist, was sie mit ihren Stellungnahmen über sich selbst aussagen.
Es ist ja nicht etwa so, dass die in den Medien ausschließlich verbreitete Meinung über die Vorgänge in Russland sich quasi von selbst verstünde, im Gegenteil: Es ist sogar ungewöhnlich schwierig, sie mit Argumenten zu stützen, und es bedarf daher eines ungewöhnlichen Maßes an Voreingenommenheit, ja Verbohrtheit, sie überhaupt vorzutragen. Gewiss gibt es in allen Lebensbereichen Menschen mit fragwürdigen Geistes- und Charaktergaben, wie eben zum Beispiel Voreingenommenheit und Verbohrtheit, und es gibt keinen Grund, warum es sie gerade in Politik und Medien nicht geben sollte. Dass sie aber alle dieselbe Art von Verbohrtheit an den Tag legen: Das ist das Aufschlussreiche!
Rechtsstaatwidrig? Die jungen Frauen haben gegen das russische Strafrecht verstoßen und wussten das. Zum Rechtsstaatsprinzip gehört, dass jede bekanntgewordene Straftat auch verfolgt werden muss. Sie im Einzelfall aus politischen oder sonstigen rechtsfremden Gründen nicht zu verfolgen: Das wäre rechtsstaatswidrig!
Unverhältnismäßig? Das Delikt, um das es geht, kann mit bis zu sieben Jahren Haft geahndet werden; da kann man eine zweijährige Haftstrafe schlecht „unverhältnismäßig“ nennen.
Willkürlich? Was als „verhältnismäßig“ zu gelten hat und was nicht, ist auch eine Frage der jeweiligen Rechtskultur. Wäre die russische Justiz sonst für ihre Milde bekannt und hätte nur in diesem einen Fall eine Freiheitsstrafe verhängt, so könnte man vielleicht von politisch motivierter Willkür sprechen. Da die russische Justiz aber generell härtere Urteile verhängt als zum Beispiel die deutsche, kann von willkürlicher Härte kaum die Rede sein; eher schon muss man dem Gericht eine für russische Verhältnisse ungewöhnliche Milde bescheinigen. Der deutsche Staat dagegen hat sich eine nichtchristliche Staatsreligion zugelegt und setzt sie mit einer Härte und Willkür durch, die der irgendeines autoritären Regimes mindestens gleichkommt:
Ein Staat wie die BRD, der brutalste Schläger mit kleinen Bewährungsstrafen davonkommen lässt, dafür aber bloße Meinungsdelikte, etwa die Holocaustleugnung, also den bloßen Dissens mit der etablierten Geschichtsauffassung, mit mehrjährigen Gefängnisstrafen ahndet – ein solcher Staat muss sich aus solchen Gründen durchaus den Vorwurf gefallen lassen, aus politischen Motiven zu unverhältnismäßiger willkürlicher Härte zu greifen – der russische aber zumindest nicht wegen Pussy Riot.
Ja, darf es denn solche Rechtsnormen überhaupt geben? Muss es nicht erlaubt sein, jederzeit und überall Jedem, auch dem, der es nicht hören will, die eigene politische Meinung oder religiöse Doktrin ins Gesicht zu schreien?
Durchaus nicht. Es muss allenfalls im öffentlichen Raum erlaubt sein, etwa auf der Straße, im Internet oder im Parlament – und selbst dort unterliegt es vernünftigerweise Einschränkungen, nicht nur in Russland. Eine Kirche ist aber kein öffentlicher Raum in dem Sinne, das sie zu jedem Unfug benutzt werden dürfte, und die Menschen, die dort hingehen, tun es, um Gott nahe zu sein, nicht aber, um mit dem ordinären Gepöbel schriller Gören konfrontiert zu werden, die ihre Gruppe ausgerechnet „Votzenrandale“ nennen.
Dieselben deutschen Journalisten, die nun glauben, es gehöre zu den Menschenrechten, in einer Kathedrale „Scheiße Scheiße Gottesscheiße“ skandieren zu dürfen, konnten sich nur zähneknirschend zu dem Eingeständnis durchringen, dass es wohl – leider, leider – nicht verboten werden könne, auf der Straße Mohammedkarikaturen hochzuhalten, und würden lauthals nach dem Kadi rufen, wenn es Islamkritikern einfiele, dasselbe in einer Moschee zu tun. Und wenn etwa Mitglieder einer rechtsextremen Rockgruppe es wagen würden, in eine Synagoge einzudringen und dort antijüdische Parolen zu rufen, dann würde die Journaille eher über die Einführung der Todesstrafe als über die „Verhältnismäßigkeit“ einer Freiheitsstrafe diskutieren.
„Pussy Riot“ konnten nur dadurch zu Heldinnen der politisch-medialen Klasse werden, dass sie in einem christlichen Gotteshaus randalierten, dass sie das Christentum durch den Schmutz zogen, und dass die Betroffenen Christen also Angehörige der Mehrheitsreligion und Russen, also Angehörige des Mehrheitsvolkes waren.
[Eines Mehrheitsvolkes zudem, möchte man 2022 im Rückblick hinzufügen, das sich der Verschwulung seines Landes widersetzt und es wagt, nicht den ideologischen Schrullen windschnittiger deutscher Queer-Ideologen, Regenbogenträger und Niederknier zu folgen. Welche Blasphemie von den Russen, nach wie vor das Kreuz anzubeten und nicht das Gendersternchen!]
Was die Votzenrandaliererinnen mit deutschen Meinungsmachern verbindet, ist der Hass auf Christen und das Christentum, der Hass auf das eigene Volk, die eigene Herkunft, die eigene Geschichte.
Identität und geschichtliche Verwurzelung des russischen Volkes werden ja durch nichts so sehr verkörpert wie durch die orthodoxe Kirche. Der Hass, der ihr und dem eigenen Volk gilt, ist der Hass des sich selbst absolut setzenden, des entwurzelten rücksichtlosen Ego auf jede Form von historischer wie sozialer Bindung und Einbindung.
Es ist der Hass von Menschen, die kein Gestern, kein Morgen und kein Wir kennen, auf die Institution, deren schiere Existenz sie daran erinnert, dass sie seelische Krüppel sind. Es ist der Hass von Menschen, die sich nur frei fühlen, wenn sie das, was ihnen unbegreiflich und unerreichbar ist, in jenen Schmutz ziehen dürfen, in dem sie selbst sich suhlen, weil sie ein Teil davon sind. Es ist der Hass des Hässlichen auf das Schöne, des Niedrigen auf das Erhabene, des Nichtigen auf das Ewige. Es ist der Hass des Asozialen auf den Anstand.
Gerade in der zur Schau getragenen Asozialität der jungen Frauen erkennt die westliche Meinungs-„Elite“ sich wieder, deren Mitglieder ihre eigene Unreife und missglückte Sozialisation notdürftig unter Nadelstreifen verstecken. Die Votzenrandale ist genau das, was sie selbst gerne praktizieren würden und auch tatsächlich praktizieren, nur dass sie es nötig haben, ihre ordinäre Destruktivität als „Liberalität“ zu bemänteln, während sie daran arbeiten, die Kloake in ihren Köpfen zuerst als Ideologie durchzusetzen und dann als Zustand der Gesellschaft zu verallgemeinern. Pussy Riot und die deutsche Medien-Ochlokratie sind Brüder und Schwestern im Geiste des Abschaums.
[Leicht überarbeitete Fassung meines Artikels „Pussy Riot und die deutsche Ochlokratie“ vom 19. August 2012.]
Anmerkungen zum Ukraine-Krieg
Jetzt, da die russische Armee den Ring um die ukrainischen Großstädte, namentlich Kiew, Odessa und Mariupol immer enger zieht und die ukrainische Seite diese Städte immer mehr zu Festungen ausbaut, ist es Zeit zu einer kurzen Betrachtung, und zwar zu einer nüchternen Betrachtung.
Ein Wort zur Mainstreampropaganda
Die Situation ist bedrohlich, nicht nur für die Ukraine und die dortige Zivilbevölkerung, sondern für uns alle. Es ist keine Situation, in der man sich von billiger Empörung über den „russischen Angriffskrieg“ den Verstand vernebeln lassen sollte. Dass uns die gewollte Selbstverdummung von Politikern und Journalisten als staatsbürgerliche Tugend verkauft wird, heißt nicht, dass es eine ist.
Es zeigt nur, dass wichtige Positionen dieser Gesellschaft von Leuten besetzt sind, die nicht wissen, wovon sie reden und es deshalb nötig haben, jeden, der sich nicht auf das Niveau ihrer infantilen und infantilisierenden Emotionalisierung und Personalisierung herablässt, zu verteufeln und einen „Putinversteher“ zu nennen.
Ich für meinen Teil bekenne mich dazu, ein Putinversteher zu sein, und zwar in demselben Sinne, in dem man Willy Brandt einen „Breschnew-Versteher“ hätte nennen können, wenn es diesen Ausdruck vor fünfzig Jahren schon gegeben hätte. Es gab ihn aber nicht, weil es damals noch als Selbstverständlichkeit galt, dass man die Dinge und die Personen, über die man sich öffentlich äußert, tunlichst verstehen sollte, weil man sonst nur dummes Zeug über sie reden kann. Dass die Journaille heute einen Ausdruck wie „Putinversteher“ als Schimpfwort verwenden kann, ohne zu bemerken, was sie damit über sich selbst aussagt, ist bezeichnend für ihre erschütternde Einfalt.
Die militärische Strategie der Ukraine
Welche Strategie also verfolgt die Ukraine, indem sie Großstädte verteidigt und es dadurch darauf anlegt, die russischen Streitkräfte in den Häuserkampf zu zwingen? Gewiss, beim Kampf „Infanterie gegen Infanterie“ hat die verteidigende Partei im Straßen- und Häuserkampf einen Vorteil, den sie in offenem Gelände nicht oder jedenfalls nicht im selben Maße hat.
Nun ist dieser Sachverhalt aber sowohl dem russischen als auch dem ukrainischen Generalstab geläufig. Niemand wird daher etwas anderes erwarten, als dass die Russen, bevor sie bei einem Angriff auf die Großstädte mit Infanterie hineingehen, stattdessen mit der geballten Feuerkraft ihrer Artillerie und Luftwaffe zuerst alle potenziellen Verteidigungsstellungen vernichten – und zwar mitsamt den Verteidigern und leider auch zahllosen Zivilisten, denen jede Ausweichmöglichkeit genommen wird, wenn die eigene Stadt zur Festung ausgebaut wird.
Und nein, diese Angriffsmethode ist keine ungewöhnlich grausame Art der Kriegführung. Es ist das, was jeder General in der Situation der russischen Kommandeure tun würde. Genau deswegen verteidigt man Großstädte normalerweise nicht – weil ihre Verteidigung nicht mehr und nicht weniger bedeutet, als den Tod eines erheblichen Teils ihrer Bewohner in Kauf zu nehmen.
Eine solche Verteidigungsstrategie kann nur in Betracht kommen, wenn die verteidigende Partei in der absolut verzweifelten Lage ist, eine militärische Niederlage um jeden Preis – und sei es den eines Massensterbens der eigenen Bevölkerung – abwenden oder dies wenigstens versuchen zu müssen (denn groß sind die militärischen Erfolgsaussichten ja nicht).
Die russischen Kriegsziele
Ist die Lage der Ukraine denn so verzweifelt, dass sie zu solchen Mitteln greifen müsste? Spätestens seit der Kreml seine Kriegsziele auf den Tisch gelegt hat, wird man dies bezweifeln dürfen. Gefordert wird im Wesentlichen:
- die Anerkennung der Zugehörigkeit der Krim zu Russland
- die Anerkennung der Unabhängigkeit der Sezessionsgebiete in der Ost-Ukraine
- die militärische Neutralität der Ukraine, sprich: dass sie nicht der NATO beitritt.
Was Putin also fordert, ist die rechtliche Anerkennung und Festschreibung von Zuständen, die de facto schon längst existierten, also des Status Quo ante: Die Ukraine kontrolliert die strittigen Gebiete (deren Bewohner obendrein offensichtlich nicht zur Ukraine gehören möchten) schon lange nicht mehr, und der NATO hat sie noch nie angehört. Russlands Kriegsziel ist offenbar gerade nicht, daran etwas zu ändern, sondern zu verhindern, die Ukraine selbst es tut – und zwar im Verbund mit dem Westen, wie es sich in den letzten Jahren immer deutlicher abgezeichnet hat.
Schon deshalb kann ich in den Forderungen Russlands nichts Unzumutbares, ja nicht einmal etwas wirklich Unbilliges erkennen, und schon gar nicht etwas, was es rechtfertigen würde, zu seiner Verhinderung das Leben von möglicherweise mehreren hunderttausend Zivilisten zu opfern.
Stärkung der Verhandlungsmacht
Es ist immerhin möglich, dass die Strategie der Ukraine gar nicht darin besteht, den Kampf um die Großstädte wirklich zu führen, sondern dem Kreml zu signalisieren, dass er für seinen Sieg einen schwindelerregend hohen Preis würde zahlen müssen. In der Tat müssten ja nicht nur viele Zivilisten ihr Leben lassen, sondern auch viele russische Soldaten, und die Sanktionen des Westens sind für Putin mindestens ziemlich lästig, ganz abgesehen von der PR-Katastrophe, die dieser Krieg für ihn jetzt schon ist. Er hat also durchaus ein Interesse daran, den Waffengang zügig zu beenden.
Unter diesem Gesichtspunkt, nämlich insofern es die Verhandlungsposition der Ukraine gestärkt hat, war die ukrainische Strategie der Totalverteidigung nicht nur verständlich, sondern auch richtig (wie es aus demselben Grund übrigens auch die Sanktionspolitik des Westens ist).
Nützen wird ihr diese starke Verhandlungsposition aber nur dann etwas, wenn sie auch wirklich verhandelt (und wieder gilt dasselbe analog für den Westen), und zwar jetzt, nicht erst dann, wenn die russische Armee unter riesigen Verlusten Kiew erobert hat. Damit nämlich wäre die mühsam aufgebaute starke Position verspielt und die Unabhängigkeit der Ukraine wirklich in Gefahr – was sie momentan nicht zu sein braucht.
Es war noch nie so leicht, Frieden zu schließen – aber tun muss man’s! Einfach nur catonisch zu wiederholen, die Russen müssten das Land verlassen, danach könne man reden, ist so blauäugig, dass es kaum ernstgemeint sein kann.
Ich möchte gerne glauben, dass die Unbeweglichkeit der ukrainischen Position einer typisch sowjetischen Verhandlungsstrategie von Diplomaten aus der Gromyko-Schule entspringt: bis zum letzten Moment das Pokerface wahren, winzige taktische Vorteile einsammeln und kumulieren, um schließlich doch noch eine Einigung zu erzielen. Ich habe allerdings Zweifel.
Dasselbe gilt mindestens ebenso sehr für den Westen. Putin mit Sanktionen unter Druck zu setzen, um am Verhandlungstisch mitreden zu können – ja, das hat durchaus Sinn. Welchen Sinn es unter diesem Gesichtspunkt aber haben soll, alle Türen zuzuknallen, westliche Unternehmen zum Abzug aus Russland zu nötigen, das Land zum Pariastaat zu erklären und seinen Präsidenten zum Gottseibeiuns zu verschwefeln, mit dem man nicht mehr reden dürfe, das erschließt sich mir nicht. So handelt eigentlich nur jemand, der eine Einigung nicht nur jetzt nicht erzielen, sondern auch für die Zukunft ausschließen will.
Eskalationsstrategie
Wenn die Strategie der Ukraine aber nicht auf Verhandlungen abzielen sollte – und mit jedem Tag, der ohne erkennbaren diplomatischen Fortschritt vergeht, werden meine Zweifel größer –, worauf dann? Welchen Sinn hat insbesondere die Verlagerung der Front in die Großstädte, wo man die Zivilbevölkerung dadurch maximalen Gefahren aussetzt?
Der Verdacht drängt sich auf, dass sowohl die Ukraine als auch der Westen (wer immer die wirklichen Entscheidungsträger in Washington sein mögen – der senile Präsident wohl eher nicht) eine Verständigung gar nicht wollen und möglicherweise von vornherein nicht wollten. Dies würde jedenfalls erklären, warum man die russische Armee drei Monate lang vor den Grenzen der Ukraine manövrieren ließ, ohne einen ernsthaften Versuch zur Entschärfung der Krise zu unternehmen (aber auch ohne ernsthaften Versuch, die Ukraine unter den Atomschirm der Amerikaner zu bringen).
Ja, ich gebe zu, es kann auch Inkompetenz gewesen sein. Nur fällt es mir schwer, an eine Inkompetenz zu glauben, die so verteufelte Ähnlichkeit mit einer Strategie hat.
Diese Strategie wäre dann gewesen, Putin die Ukraine als Köder hinzuhalten, indem man ihre Aufnahme in die NATO als bevorstehend an die Wand malt (und ihn so unter Zugzwang setzt), sie aber noch nicht wirklich aufnimmt (damit er glaubt, sich ein militärisches Vorgehen noch leisten zu können). Das hieße, dass man ihm eine Falle gestellt hat und er hineingetappt ist.
Sollte es so sein, dann würde auch die militärisch und politisch scheinbar so sinnlose Opferung der ukrainischen Zivilisten einen Sinn ergeben und darauf hinauslaufen, durch eine solche Eskalation den Westen in den Krieg hineinzulotsen, was Selenskyj ohnehin ständig versucht. Dass er damit immerhin eine Debatte über „Flugverbotszonen“ ausgelöst hat, Polen eine bewaffnete „Friedensmission“ der NATO zur Unterstützung der Ukraine fordert und wichtige Funktionsträger des politisch-medialen Komplexes, etwa Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner, den Kriegseintritt der NATO bereits offen propagieren, wirkt wie ein düsteres Omen und zeigt, dass Selenskyjs Spekulation auf diesen Kriegseintritt keineswegs so absurd ist, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheint.
Wir wissen aus der Vergangenheit, wie leicht die westliche Öffentlichkeit durch grausame Bilder zu manipulieren ist, und sie ist es heute mehr denn je. Die Coronakrise wirkt wie ein Probelauf, bei dem getestet wurde, wie viel offensichtlichen Unsinn diese Öffentlichkeit zu schlucken bereit ist, und das Ergebnis ist für Kriegstreiber leider ziemlich ermutigend ausgefallen. Die westliche und insbesondere die deutsche Öffentlichkeit ist in einer Weise hysterisierbar, infantilisierbar und manipulierbar, wie man es noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehalten hätte. Die sich ausbreitende Progromstimmung gegen Russen (und russische Muttersprachler, einschließlich ethnischer Deutscher), spricht eine deutliche und vernichtende Sprache.
Die Bilder, deren es bedarf, um ein solches Volk in einen Krieg zu treiben, würden bei einem Sturm auf Kiew mit Sicherheit entstehen und hätten vermutlich auch in den USA eine ähnliche Wirkung. Untermalt mit entsprechender Propaganda könnte der noch vorhandene öffentliche Widerstand gegen militärische Maßnahmen schnell dahinschmelzen, zumal, wenn der Kriegseintritt der NATO scheibchenweise erfolgt: zum Beispiel, indem zunächst „nur“ eine Flugverbotszone eingerichtet wird, „nur“ die USA sich beteiligen, „nur“ Ausbilder und Spezialisten geschickt werden usw.
Für die Vereinigten Staaten wäre das Risiko übrigens viel geringer als für uns. Konfrontiert mit einer NATO, die gegen ihn Krieg führt, hätte Putin durchaus die atomare Option – nur eben nicht gegen die USA, die womöglich mit massiver Vergeltung antworten würden, wenn ihr eigenes Territorium angegriffen wird; wohl aber gegen europäische Staaten. Die noch aus dem Kalten Krieg stammende Vorstellung, die USA würden jeden atomaren Angriff auf ein NATO-Mitglied ihrerseits mit Atomschlägen gegen Russland quittieren und damit womöglich dessen Atomraketen auf sich selbst ziehen, war damals schon fragwürdig und ist es heute erst recht.
Deswegen hätte Russland im Falle eines Krieges mit der NATO durchaus die Option, Atomraketen auf europäische Staaten abzufeuern,
- die strategisch wichtige Knotenpunkte der NATO-Infrastruktur beherbergen,
- erheblich zur Wirtschaftskraft des Westens beitragen,
- potenziell auch militärische Bedrohungen Russlands darstellen könnten,
- dabei aber selbst keine Atomwaffen besitzen.
Die Frage, auf welches Land dieser Steckbrief am deutlichsten zutrifft, beantwortet sich von selbst.
Statistische Beweise: US-Wahl wurde manipuliert
Die etablierten Massenmedien – also jene Medien, die sich nicht genug empören können, wenn man sie als „Lügenpresse“ tituliert – behaupten bekanntlich in der ihnen eigenen, bis in die Formulierungen reichenden Harmonie, die US-Republikaner beschuldigten ihre Gegner „ohne jeden Beweis“ der Wahlmanipulation.
Nun, ich weiß nicht, was man in diesen Kreisen unter einem „Beweis“ versteht, aber ich würde die Aussagen der von Rudy Giuliani seitens der Republikaner beigebrachten Zeugen sehr wohl als Beweise werten, erst recht die Tatsache, dass mitten in der Nacht ganze Schübe von wahlentscheidenden Stimmen auftauchten, die 100 Prozent pro Biden abgegeben worden sein müssen.
Ob all diese Beweise gerichtsfest sind, und ob sie – wenn sie es denn sind – für die Annullierung der Wahl ausreichen, wird sich zeigen, aber die Behauptung, die Republikaner würden „keine Beweise“ anführen, ist offensichtlich eine glatte Lüge, und weiß Gott nicht die erste aus diesen Quellen und in diesem Zusammenhang.
Diese Lüge wird auch nicht dadurch glaubwürdiger, dass die Massenmedien sie unablässig und gleichlautend wiederholen. Das einzige, was dadurch glaubwürdiger wird, ist die These, wir hätten es mit einer gleichgeschalteten Lügenpresse zu tun.
Ungeachtet dessen oder gerade deswegen ist derjenige, der sich eine Meinung darüber bilden möchte, wie korrekt oder manipuliert die US-Wahlen tatsächlich abgelaufen sind, auf zwar zahlreiche, aber doch verstreute, teils anekdotenhafte Aussagen angewiesen, die zwar ein deutliches Gesamtbild, aber noch keine Smoking Gun ergeben.
Es gibt jedoch sehr wohl wissenschaftliche Methoden, die Authentizität von Datensammlungen zu überprüfen und eventuelle Manipulationen aufzudecken. Sie beruhen auf dem Benford-Gesetz, wonach (hinreichend viele Datensätze vorausgesetzt) eine bestimmte Ziffer statistisch umso häufiger am Beginn einer Zahl auftaucht, je kleiner diese Ziffer ist:
| Führende Ziffer | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| 1 | 30,1 % |
| 2 | 17,6 % |
| 3 | 12,5 % |
| 4 | 9,7 % |
| 5 | 7,9 % |
| 6 | 6,7 % |
| 7 | 5,8 % |
| 8 | 5,1 % |
| 9 | 4,6 % |
Prüfungen auf der Basis des Benfordschen Gesetzes sind seit langem wohletablierte Mittel der Plausibilitätsprüfung etwa der Finanzbehörden bei der Aufdeckung von Steuerbetrug. Aber auch die Politikwissenschaft bedient sich dieser Mittel, und zwar bei der Aufdeckung von – Wahlbetrug.
Savva Shanaev von der Northumbria University in Newcastle hat sich dankenswerterweise die Mühe gemacht, 9000 Datensätze der Wahlergebnisse auf County- und Precinct-Ebene auszuwerten, die am 8. November verfügbar waren. Die Ergebnisse hat er in dem Video präsentiert, das ich am Ende dieses Artikels eingebunden habe.
(Ich empfehle jedem Leser, sich die Zeit zu nehmen, es sich anzusehen. Denen, die eine Fremdsprache lieber lesen als hören, leisten die bei Youtube zuschaltbaren Untertitel gute Dienste.
Um es kurz zusammenzufassen: Shanaev (der selbst übrigens mehrfach betont, dass er es ablehnt, sich eine politische Lesart seiner Befunde zu eigen zu machen und lediglich die Anwendung und den praktischen Nutzen seiner statistischen Methode demonstrieren möchte) kommt in einer ersten Analyse zu dem Ergebnis, dass Wahlmanipulationen bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit stattgefunden haben dürften:
USA gesamt
Der p-Wert, von dem im Folgenden die Rede sein wird, ist ein statistischer Wert, der im vorliegenden Zusammenhang eine Aussage darüber zulässt, ob das Wahlergebnis ohne Manipulation zustandegekommen ist. Je niedriger er liegt, desto wahrscheinlicher ist Manipulation im Spiel. (Ich folge Shanaev, wenn ich den p-Wert in Prozent darstelle statt in Bruchteilen von 1, weil dies für die Leser leichter zu erfassen sein dürfte.)
Dieser p-Wert also liegt für die Gesamtheit der erfassten Ergebnisse der US-Wahl landesweit bei 3,84 %. Im Allgemeinen gilt ein Wert unter 5 Prozent als signifikant, das heißt er besagt im vorliegenden Zusammenhang, dass das Ergebnis wahrscheinlich durch gezielte Wahlmanipulation zustandegekommen ist. (Dieser Schwellwert von 5 % ist eine Konvention, die sich etabliert hat. Sie besagt also nicht etwa, dass ein Wert, der knapp darüberliegt, überhaupt keine Aussagekraft hätte.)
Über die gesamten USA hinweg betrachtet, liegt der Wert für die republikanischen Stimmern bei 3,18, für die Demokraten bei 5,52. Insgesamt weichen die führenden Ziffern der Stimmen der Republikaner mit höherer Signifikanz von der zu erwartenden Verteilung ab als die der Demokraten.
Erste Differenzierung: Trump-Staaten versus Biden-Staaten
Um die Quelle dieser Abnormalitäten einzukreisen, unterscheidet Shanaev in einem zweiten Schritt zwischen Staaten, in denen Trump gewonnen hat, und solchen, die Biden für sich verbuchen konnte, und kommt zu folgendem Ergebnis:
In den Trump-Staaten kann Wahlmanipulation, soweit sie an Benfords Gesetz gemessen wird, praktisch ausgeschlossen werden: Die entsprechenden p-Werte (Nochmal: Je niedriger der Wert, desto wahrscheinlicher die Manipulation, je höher, desto unwahrscheinlicher) betragen 32,2 % für die Demokraten, 45,89 % für die Republikaner und 53,19 % insgesamt. (Nur als Hinweis: Der Gesamtwert ist naturgemäß kein Durchschnitt aus den Einzelwerten.)
In den von Biden gewonnenen Staaten dagegen zeigt sich ein ganz anderes Bild: Hier liegt der Wert für die Demokraten bei sehr signifikanten 0,53 %, der für die Republikaner bei 5,36 %, der Gesamtwert bei 1,06 %.
Zweite Differenzierung: Rote Staaten, blaue Staaten, Swing-Staaten
Hierbei handelt es sich um drei Staatengruppen, die sich nach der Vorhersagbarkeit des Ergebnisses unterschieden: „Rote“ Staaten sind solche, in denen von vornherein feststand, dass Trump gewinnen würde, „blaue“ dementsprechend die, in denen klar war, dass Biden das Rennen machen würde, und die berühmten „Swing“- oder „Battleground“-Staaten diejenigen, von denen man wusste, dass sie umkämpft sein würden – und die es dann auch waren:
Rote Staaten
Für die roten Staaten gilt dasselbe wie für die Trump-Staaten (d.h. die Gesamtheit der von Trump gewonnenen Swing-Staaten plus rote Staaten): Manipulation können wir ausschließen: Die p-Werte lauten 57,85 % für die Demokraten, 36,92 % für die Republikaner, 70,82 % insgesamt.
Blaue Staaten
In den blauen Staaten zeigt sich ein Kuriosum: Obwohl es sich um Staaten handelt, in denen keine Manipulation der Welt einen Wahlsieg der Demokraten hätte verhindern können, ist es zu Wahlmanipulationen gekommen – und betroffen waren die republikanischen Stimmen (p-Wert 1,11 % gegen 12,31 % bei den Demokraten und 1,92 % insgesamt).
Bei der Interpretation dieses Befundes ist Shanaaev ratlos und empfiehlt eine genauere Untersuchung. In der Tat: Welchen Sinn hätte es für die Republikaner gehabt, Aufwand zu treiben, um die Wahlen in einem Staat zu manipulieren, den sie ohnehin nicht gewinnen können?
Meine Vermutung beruht auf der Überlegung, dass Manipulation auch darin bestehen kann, Stimmen des Gegners zu unterschlagen, und dies erfordert wesentlich weniger Aufwand (Man braucht nur gültige Stimmen für den Gegner als ungültig zu werten.), als fiktive Stimmen ins System einzuschleusen, und ist umso einfacher zu bewerkstelligen, je größer die eigene Mehrheit und je weniger Gegner daher unter den Wahlbeobachtern sind. Vielleicht hätte Shanaev sich weniger gewundert, wenn er Befunde aus Deutschland gekannt hätte, wo in der Vergangenheit (ebenfalls auf der Basis des Benford-Gesetzes) Manipulationen nachgewiesen wurden, die die jeweils dominante Partei begünstigten.
Wie dem auch sei: Wahlentscheidend waren diese Manipulationen, wie immer sie zustandegekommen sind, nicht, weil sie in Staaten stattfanden, die ohnehin den Demokraten zufallen mussten.
Entscheidend waren vielmehr die
Swing-Staaten
Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, North Carolina, Ohio, Pennsylvania und Wisconsin.
Und hier ist der Befund eindeutig und niederschmetternd für alle, die allen Ernstes daran glauben, mit den Präsidentschaftswahlen sei „die Demokratie gerettet“ worden:
Während in den Swing States nämlich der p-Wert für die Republikaner 60,63 % und insgesamt 41,04 % beträgt, beläuft er sich für die Demokraten auf 1,97 %!
Das heißt: In diesen entscheidenden Staaten, in denen ohnehin auch ohne statistische Analyse Unregelmäßigkeiten zu erkennen waren, in Staaten, von denen einige im Laufe der Auszählung überraschend auf die Seite der Demokraten gekippt sind und von ihnen letztlich gewonnen wurden, ist es – statistisch nachweisbar! – mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu massiven Manipulationen zu Gunsten von Joe Biden gekommen.
Fazit: Wir müssen davon ausgehen, dass Trumps Behauptung, die Wahl sei gestohlen worden, den Tatsachen entspricht.
[Nachtrag 26.5.2022: Shanaev hat sein Video inzwischen auf „privat“ gestellt und auf meine per E-Post übermittelte Frage nach den Gründen nicht geantwortet. Die von ihm im Video verwendeten Excel-Tabellen (Dateiname NEDL_election_51.xlsx) sind aber noch abrufbar bei Google Drive. Bitte hier klicken.]
Was wir an Trump finden?
Viele Mitbürger fragen sich, was die oppositionelle Rechte auch in Deutschland an Trump findet.
Ist er sympathisch? Nein.
Würde eine US-Präsident, den die Rechte sich selber backen könnte, so aussehen wie Trump? Nein.
Hat er wenigstens ihre Erwartungen erfüllt? Bestenfalls teilweise.
Warum würden sie ihn dann wählen, wenn sie könnten?
Weil Trump der Sand im Getriebe einer Maschinerie ist, deren fortgesetztes Wüten sich gegen die Interessen der großen Mehrheit aller Europäer und Amerikaner richtet.
Ein US-Präsident ist nicht allmächtig, sondern in zahllose Zwänge und ein äußerst komplexes System eingebunden. Schon dadurch sind ihm enge Grenzen gesetzt. Bestenfalls kann er das System bremsen und behindern, das einen so verderblichen Kurs einschlägt. Genau das hat Trump getan, und viel mehr hätte er auch dann nicht erreichen können, wenn er das System besser durchschaute, als er es vermutlich tut.
Sein Gegenkandidat dagegen ist das personifizierte Establishment. Persönlich mag er sympathischer sein, das braucht aber außer seinem persönlichen Umfeld niemanden zu interessieren, weil es sonst niemanden betrifft.
Ein letztes Wort an die Adresse derjenigen, die immer noch der Mainstreampresse und deren Lesart der aktuellen Ereignisse in den USA auf den Leim gehen:
Trump bezweifelt, dass die Wahl rechtmäßig verläuft. Angesichts
- von Briefwahlergebnissen, die so einseitig sind, dass sich die Frage nach der Korrektheit ihres Zustandekommens geradezu aufdrängt,
- der Tatsache, dass Stimmen gewertet werden, die nach Schließung der Wahllokale eingegangen sind,
- und deren fristgerechte Aufgabe bestenfalls durch einen Poststempel beglaubigt wird, der leicht zu fälschen ist,
- die aber, einmal ausgezählt, nicht mehr von den unzweifelhaft korrekt abgegebenen Stimmen unterscheidbar sind,
- deren eventuelle gerichtliche Annullierung daher entweder eine Wiederholung der ganzen Wahl oder die Akzeptanz eines unsauber zustandegekommenen Wahlergebnisses erforderlich machen würde,
ist es nicht nur Trumps gutes Recht, sondern geradezu seine Pflicht, die Wertung dieser Stimmen gerichtlich überprüfen zu lassen und zu erwirken, dass ihre weitere Auszählung bis zu einer gerichtlichen Entscheidung darüber auf Eis gelegt wird.
Durch ein solches Vorgehen wird NIEMAND in seinen Rechten beeinträchtigt – sofern es sich denn wirklich um Rechte handelt und nicht um bloße Machtusurpationen. Auch nicht Joe Biden: Denn vor dem 20. Januar kann Biden das Amt auf gar keinen Fall übernehmen. Eine juristische Klärung abzuwarten, bleibt also genug Zeit – jedenfalls für den, der eine solche Klärung nicht zu fürchten braucht.
Lügenpresse in Hochform
Seit Donald Trump gestern ankündigte, gegen die Wertung weiterer Briefwahlstimmen vor Gericht ziehen zu wollen, ist auf allen, aber wirklich allen Kanälen der etablierten deutschen Massenmedien zu hören, er wolle „die Auszählung der Stimmen stoppen“.
Stimmt das überhaupt?
Laut der Niederschrift auf newsweek.com lautet die einschlägige Passage seiner Rede wie folgt:
Wir wollen, dass die Gesetze korrekt angewendet werden. Daher werden wir vor den Obersten Gerichtshof ziehen. Wir wollen, dass nicht weiter gewählt wird. Wir wollen nicht, dass um 4 Uhr morgens noch irgendwelche Wahlzettel gefunden und mit auf die Liste gesetzt werden.
Trump hat also keineswegs gefordert, die Auszählung, sondern die Wahl („voting“) zu beenden: Er will, dass Stimmen, die jetzt, also nach Schließung der Wahllokale noch eingehen, nicht mehr mitgezählt werden dürfen.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in den Redaktionen deutscher Massenmedien kein einziger Journalist den Unterschied zwischen „voting“ und „counting“ kennen soll. Die Fehlübersetzung ist also Absicht, das Wort „Lügenpresse“ erweist sich wieder einmal als gerechtfertigt.
Des Weiteren hat Trump angekündigt, vor Gericht zu ziehen, um die gesetzmäßigen Verlauf der Wahl überprüfen zu lassen. Dies ist offensichtlich sein gutes Recht, und es ist das übliche und vorgesehene Verfahren in einem Rechtsstaat, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Wahlverlaufs bestehen.
Wenn die Medien als willige Sprachrohre hysterischer US-Linker ein solches, völlig korrektes Vorgehen als illegitim, gar als antidemokratisch hinstellen, so wirft dies in der Tat ein beunruhigendes Licht auf das Demokratieverständnis wichtiger Akteure – allerdings nicht auf das von Donald Trump, sondern auf das seiner Gegner. Und auf das ihrer Gesinnungsfreunde innerhalb des politisch-medialen Komplexes in Deutschland.
Bis gestern hielt ich Trumps Warnungen vor einem Wahlbetrug der Demokraten für Panikmache. Deren Reaktion hat mich aber eines Schlechteren belehrt.
Wer nämlich eine gerichtliche Überprüfung so offensichtlich fürchtet wie Bidens Partei, muss schon verdammt viel Dreck am Stecken haben.
Nena und das Tal der Aussätzigen
Nun hat es also auch Nena erwischt. Die Popsängerin („99 Luftballons“) ist mit diesem Beitrag auf Instagram in die Schlagzeilen geraten:
Was daran so empörend ist?
Dass ihr Kollege Xavier Naidoo, der schon vor Monaten von den Massenmedien ins Tal der Aussätzigen verbannt wurde, diesen Beitrag mit „Gefällt mir“ markiert und Nena selbst dieses Like erwidert hat.
Das geht natürlich gar nicht, und so erntet nun auch Nena den Shitstorm aufgescheuchter Gesinnungswächter, die in den sozialen Medien das ihrer Mentalität angemessene Betätigungsfeld gefunden haben.
Die Massenmedien dagegen versuchen es aktuell noch mit der Gelben Karte, das heißt sie kleiden ihre Unterstellungen und versteckten Drohungen in die Frage- beziehungsweise Zitatform:
„Ist Nena eine Corona-Leugnerin?“ (Express.de; für bereits Abgestumpfte: Man beachte die Wortwahl!)
„Lassen sich ihre Thesen wirklich ins Lager der Corona-Leugner verorten?“ (t-online.de; dito)
„Zu den Instagram-Nutzern, die den Beitrag positiv kommentierten, gehört auch Xavier Naidoo. Der Sänger war in der Vergangenheit wiederholt mit Verschwörungstheorien aufgefallen (…) Für viele Nutzer der sozialen Medien offenbar Beweis genug, dass Nena einen ähnlichen Weg einschlagen könnte wie die Corona-Leugner Attila Hildmann oder Michael Wendler. “ (RP-online.de; dito)
Noch zögern die Medienschreiber – vielleicht dämmert ihren Chefs, dass sie drauf und dran sind, sich ganze Generationen von Künstlern so zu entfremden wie ihre Vorgänger in der DDR es 1976 im Zusammenhang mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann getan haben. Ganz verzichten wollen sie auf die Drohung mit Deportation ins Tal der Aussätzigen freilich nicht, und sie verpacken diese Drohung nicht einmal besonders geschickt.
Wenn ich also meinen alten Essay „Das Tal der Aussätzigen“ hier noch einmal einstelle, dann nicht etwa aus Phantasielosigkeit, sondern weil er leider in den zehn Jahren seit seiner Erstveröffentlichung an Aktualität noch gewonnen hat:
Das Tal der Aussätzigen
Unter zivilisierten Menschen sollte es selbstverständlich sein, die Meinung eines Andersdenkenden mit Argumenten zu kritisieren, oder sie einfach dadurch zu kritisieren, dass man die eigene Meinung ausspricht, möglichst mit Argumenten untermauert. Dies impliziert dann bereits die Kritik an anderen Auffassungen. Und selbstredend ist es jedermanns gutes Recht, die Meinung des Anderen überhaupt nicht zu kommentieren und die eigene Meinung für sich zu behalten.
Wäre dies Allgemeingut, dann gäbe es in Deutschland eine zivilisierte Debattenkultur. Solche Spielregeln würden allerdings implizieren, dass niemand die Diskursherrschaft hat; es wäre geradezu ein herrschaftsfreier Diskurs – also etwas, das von denen am wenigsten eingelöst wird, die sich am lautesten darauf berufen.
Diskursherrschaft bedeutet die Macht zu definieren, was in seriösen Zusammenhängen gesagt werden darf und was nicht. Herrschend ist, wer die Grenze definiert, jenseits derer das Tal der Aussätzigen beginnt. Dies setzt voraus, dass die Gesellschaft akzeptiert, dass es so etwas wie ein Tal der Aussätzigen überhaupt gibt.
In Deutschland gilt als Konsens, dass Rechtsextremisten Aussätzige sind. Dass an diesem Prinzip etwas verkehrt sein könnte, merkt man, wenn man sich die Konsequenzen klarmacht: Wer mit dem Aussätzigen Kontakt hat, gilt als infiziert, sofern er sich nicht einer Desinfektionsprozedur in Gestalt wortreicher Distanzierungen unterwirft. Wer dies unterlässt, sich also nicht distanziert, wird ebenfalls ins Tal der Aussätzigen abgeschoben, was wiederum Alle, die mit ihm Kontakt haben oder hatten, zwingt, sich ihrerseits zu distanzieren.
Wer als anständiger Mensch gelten will, muss sich nicht nur von Rechtsextremisten distanzieren, er muss sich auch von denen distanzieren, die sich nicht distanzieren. Und von denen, die sich von denen, die sich nicht distanzieren, nicht distanzieren. Und von denen, die sich von denen, die sich von denen, die sich nicht distanzieren, nicht distanzieren, nicht distanzieren.
Eine Gesellschaft, die die Existenz eines Tals der Aussätzigen akzeptiert und die ideologische Apartheid zur Grundregel des öffentlichen Diskurses erhebt, setzt eine Kettenreaktion in Gang, aufgrund derer immer größere Teile des Meinungsspektrums im Nirwana des Unsagbaren verschwinden. Das beginnt mit Nazi-Positionen, aber es endet nicht, solange nicht alle Positionen geächtet sind, die mit einer linken oder radikalliberalen Ideologie unvereinbar sind.
Je weiter sich das Tal der Aussätzigen in die Meinungslandschaft vorfrisst, desto länger werden seine Grenzen, und desto größer wird die Anzahl derer, dieim Einzugsbereich dieser Grenzen leben; die mithin unter dem Zwang stehen zu beweisen, dass sie sich keinesfalls mit dem Aussatz infiziert haben; die sich also für das, was sie denken, und wäre es noch so wahr, entschuldigen müssen. So entsteht ein Klima, in dem immer größere Teile des Volkes verdächtig sind, während die, die den Verdacht aussprechen, dies selbstredend nicht sind.
In einer freien Gesellschaft wäre es undenkbar, dass zum Beispiel ein militant rechtsliberaler Blog wie PI als „rechtsradikal“ verunglimpft wird – eine solche Verdächtigung würde, ihrer offenkundigen Absurdität wegen, den Denunzianten zur komischen Figur stempeln. In unserer Gesellschaft dagegen, in der die Existenz des Tals der Aussätzigen jeden Nonkonformisten mit Deportation bedroht, muss nicht der Verleumder sich rechtfertigen, sondern der Verleumdete.
Wer unter dem Zwang steht zu beweisen, dass seine Ansichten keineswegs mit denen des Aussätzigen X identisch sind, ist nicht nur unfrei. Er wird sich, da Argumente ja ohnehin nicht zählen, seinerseits einen Y suchen, den er als aussatzverdächtig denunzieren kann, und er wird hoffen, dass bereits die Denunziation ihm ein Alibi verschafft. (Man denke an manchen „Islamkritiker“ und seine hysterische Verleumdung von Organisationen wie den Pro-Parteien.)
So entsteht eine Republik der Angst, eine Jakobinerherrschaft, in der die Ächtung die Guillotine ersetzt.
„Verschwörungstheorie“, „Coronaleugner“: Michael Wendler und die Orgie der Unwörter
Wer hätte für möglich gehalten, dass der höchstens mäßig erfolgreiche Schlagersänger Michael Wendler einmal in diesem Blog Erwähnung finden würde?
(Für die, die ihn nicht kennen: Sie haben künstlerisch nicht allzu viel versäumt, Wendler erzielt einen erheblichen Teil seiner Einnahmen damit, durch Trashfernsehformate der RTL-Gruppe zu tingeln und im Übrigen sein Privatleben und das seiner 30 Jahre jüngeren Frischangetrauten für Tratschsendungen auszubreiten.)
 Nachdem RTL über Jahre hinweg sein Möglichstes getan hat, besagten Herrn Wendler zu einer Art Clown der Nation aufzubauen, lässt es ihn nun fallen, denn Wendler hat etwas Unverzeihliches getan: Er hat sich zu einem politischen Thema geäußert und es dabei an Botmäßigkeit gegenüber den Regierenden fehlen lassen. Konkret sagte er seine Teilnahme an der Jury der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ mit der Begründung ab, er protestiere damit gegen die Corona-Politik der Bundesregierung, weil diese gegen das Grundgesetz verstoße. In diesem Zusammenhang benutzte er den Ausdruck „angebliche Corona-Pandemie“ und warf den Medien Mitverantwortung vor, da sie „gleichgeschaltet“ und „politisch gesteuert“ seien.
Nachdem RTL über Jahre hinweg sein Möglichstes getan hat, besagten Herrn Wendler zu einer Art Clown der Nation aufzubauen, lässt es ihn nun fallen, denn Wendler hat etwas Unverzeihliches getan: Er hat sich zu einem politischen Thema geäußert und es dabei an Botmäßigkeit gegenüber den Regierenden fehlen lassen. Konkret sagte er seine Teilnahme an der Jury der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ mit der Begründung ab, er protestiere damit gegen die Corona-Politik der Bundesregierung, weil diese gegen das Grundgesetz verstoße. In diesem Zusammenhang benutzte er den Ausdruck „angebliche Corona-Pandemie“ und warf den Medien Mitverantwortung vor, da sie „gleichgeschaltet“ und „politisch gesteuert“ seien.
Die so angegriffenen Medien nun haben daraufhin eine offenkundige Kampagne losgetreten: Als sei Wendler der Bundespräsident und hätte in dieser Eigenschaft mindestens die Legalisierung von Kinderprostitution gefordert, füllt der „Wendler-Eklat“ seit Tagen die Bildschirme und Pressespalten, und bis ins Wortmaterial hinein bedienen sich alle desselben Vokabulars: Wendler sei ein „Coronaleugner“, der „Verschwörungstheorien“ verbreite. Selbstverständlich durften auch die Beiworte „wirr“ und „krude“ nicht fehlen, die in solchen Zusammenhängen mit größerer Sicherheit zu fallen pflegen als heutzutage das sprichwörtliche Amen in der Kirche.
Dieselben Medien also, die mit der glockenreinen Harmonie eines Kinderchors dasselbe singen, verwahren sich voller Entrüstung dagegen, „gleichgeschaltet“ zu sein.
Dieselben Medien, die Kritik an den Regierenden für ungehörig, ja geradezu blasphemisch erklären, und mit jedem Wort, das sie von sich geben, betonhart den Eindruck untermauern, politisch gesteuert zu sein – diese Medien also erklären jeden zum Wirrkopf, der ihnen unterstellt, eben dies, nämlich politisch gesteuert zu sein.
Gerade das Wort „Verschwörungstheorie“ ist in diesem Zusammenhang besonders belustigend, denn von einer Verschwörung hat Wendler gar nicht gesprochen, auch nicht implizit. Es handelt sich also um ein völlig unangemessenes Wort, und man sollte meinen, dass Journalisten dies bemerken, zumal wenigstens ihr Deutsch im Allgemeinen besser ist als das von Herrn Wendler. Wir könnten uns nun fragen, wie es kommt, dass immerhin einige hundert Journalisten es fertigbringen, unabhängig voneinander dieselbe dumme, falsche und schiefe Etikettierung zu verwenden.
So wie wir uns auch fragen können, wie es kommt, dass (mindestens) einige hundert politische Entscheidungsträger dieselben katastrophalen Fehlentscheidungen treffen beziehungsweise gutheißen, und dies über Jahre hinweg: beim Euro, bei der Immigrationspolitik, der „Flüchtlings“-Krise, nun also bei Corona…
Nein, wir brauchen diesen Politikern nicht unbedingt eine Verschwörung zu unterstellen: Die meisten dürfte eine Mischung aus Karrieregeilheit, Rückgratlosigkeit, Dummheit, Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit ausreichend motivieren, eine Politik mitzutragen, die das ihnen anvertraute Land ins Verderben führt – und Entsprechendes dürfte für die ihnen sekundierende Journaille gelten.
Horst Seehofer hat übrigens einmal im Zusammenhang mit der Eurokrise in einem seltenen und desto dankenswerteren Anfall von Ehrlichkeit ein wichtige Einsicht auf den Punkt gebracht:
Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Unter Politikwissenschaftlern ist diese Erkenntnis übrigens ein Gemeinplatz. Hätte aber ein Anderer sie öffentlich formuliert und den Regierenden womöglich mit kritischem Tenor entgegengehalten, er wäre zweifellos als „Verschwörungstheoretiker“ abgemeiert worden.
Da Mitläufer etwas brauchen, bei dem sie mitlaufen können, muss es auch in der Politik beziehungsweise deren Dunstkreis durchaus ein paar Leute geben, die genau wissen, was sie tun – und die das politisch-mediale Fußvolk hinter sich herziehen: ein Fußvolk aus professionellen Gremiensitzern und Was-mit-Medien-Typen (gerne auch mit abgebrochenem Studium oder gefälschter Doktorarbeit), die die Verantwortung beziehungsweise Propaganda für etwas übernehmen, was sie nicht verstehen und auch gar nicht erst zu verstehen versuchen: Zu groß ist die Gefahr, zu Erkenntnissen zu gelangen, die mit dem von oben geforderten Glauben unvereinbar wären.
Ich verwende das Wort „Glauben“ im vollen religiösen Sinne des Wortes: Wo es nämlich einen „Leugner“, zum Beispiel also einen „Coronaleugner“ gibt, muss es eine ein für allemal feststehende, unhinterfragbar richtige Wahrheit geben, die man nicht einmal kritisieren, sondern nur „leugnen“ kann, sofern man sie (böswilligerweise, versteht sich) in Abrede stellen möchte. Der „Coronaleugner“ ist das jüngste Mitglied des rapide wachsenden Clubs der „Leugner“, der mit dem „Holocaustleugner“ ins Leben gerufen wurde, dem alsbald der „Klimaleugner“ zur Seite gestellt wurde.
Aus der Sicht des regierungsfrommen Spießbürgers versteht es sich sozusagen von selbst, dass die so Etikettierten nur Abgesandte des Bösen sein können, denen man keinerlei Toleranz schuldet, auch keine Fairness. Und daher werden wir auch im Zusammenhang mit Klima und Corona noch erleben, was im Zusammenhang mit der „Holocaustleugnung“ schon einmal durchexerziert wurde: dass dieser Staat sich mit zunehmender Hemmungslosigkeit das Recht nehmen wird, „Wahrheit“ durch politische Entscheidung von oben zu dekretieren. Wenn aber Sachverhalte der Kritik entrückt werden, dann usurpiert der Staat die Rolle eines Religionsstifters.
Was wir hier erleben, ist die Verwandlung eines liberalen Staates in eine Theokratie, einen bizarren Wiedergänger des Alten Rom: Erkannte man einen guten Bürger des römischen Imperiums daran, dass er bereit war, den Kaiser als Gott zu verehren, so wird die Loyalität eines Bürgers der BRD daran gemessen werden, ob er der Staatsgöttin Corona (und der zweifellos noch wachsenden Schar ihrer Kolleginnen) huldigt und opfert.
Und wer es nicht tut, wird den Löwen zum Fraß vorgeworfen.
Passend zum Thema:

Ehemaliger Pfizer-Wissenschaftsvorstand erklärt: „Zweite Welle“ auf der Basis falsch-positiver COVID-Tests fingiert: „Pandemie ist vorbei“
Von Ralph Lopez
(Erstveröffentlichung in Englisch: HubPages, 23. September 2020, Übersetzung von Manfred Kleine-Hartlage auf der Basis der Veröffentlichung in Global Research, 24. September 2020)
In einer verblüffenden Wendung erklärt ein ehemaliger Chief Science Officer des Pharmariesen Pfizer, es gebe „keine wissenschaftliche Studie, die auf eine zweite Welle schließen lässt“. Der „Big Pharma“-Insider behauptet, falsch positive Ergebnisse von inhärent unzuverlässigen COVID-Tests würden zur Fingierung einer „zweiten Welle“ auf der Grundlage „neuer Fälle“ missbraucht.
Dr. Mike Yeadon, ein ehemaliger Vizepräsident und 16 Jahre lang Chief Science Officer bei Pfizer, sagt, dass die Hälfte oder sogar „fast alle“ COVID-Tests falsch positiv seien. Dr. Yeadon vertritt auch die Auffassung, dass die Schwelle für Herdenimmunität viel niedriger sein könnte als bisher angenommen und in vielen Ländern bereits erreicht worden sein könnte.
In einem Interview letzte Woche wurde Dr. Yeadon gefragt:
„Man stützt also eine Regierungspolitik, eine Wirtschaftspolitik, eine Bürgerrechtspolitik, was die Beschränkung auf sechs Personen in einem Zusammentreffen betrifft… alles auf möglicherweise völlig gefälschte Daten über dieses Coronavirus…?“
Dr. Yeadon antwortete mit einem einfachen „Ja“.
Dr. Yeadon sagte in dem Interview, dass angesichts der „Form“ aller wichtigen Indikatoren einer weltweiten Pandemie, wie Krankenhausaufenthalte, Nutzung der Intensivstationen und Todesfälle, „die Pandemie im Grunde genommen vorbei ist“.
Yeadon sagte in dem Interview: „Die Pandemie ist grundsätzlich vorbei:
„Ohne die Testdaten, die Sie ständig aus dem Fernsehen erhalten, würden Sie zu Recht zu dem Schluss kommen, dass die Pandemie vorbei ist, da nicht viel passiert ist. Natürlich gehen die Menschen ins Krankenhaus, um sich auf die herbstliche Grippesaison vorzubereiten… aber es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass eine zweite Welle auftreten sollte“.
In einem in diesem Monat veröffentlichten Artikel, der von Yeadon und zwei seiner Kollegen gemeinsam verfasst wurde, fragen die Wissenschaftler: „Wie wahrscheinlich ist eine zweite Welle?“
„Es wurde allgemein beobachtet, dass in allen stark infizierten Ländern in Europa und in mehreren US-Bundesstaaten gleichermaßen die Form zeitlichen Verlaufskurven ähnlich ist wie bei uns in Großbritannien. Viele dieser Kurven sind nicht nur ähnlich, sondern fast deckungsgleich“.
Aus den Daten für Großbritannien, Schweden, die USA und die Welt geht hervor, dass die Todesfälle in allen Fällen von März bis Mitte oder Ende April anstiegen, dann sanken. Die Kurve flachte gegen Ende Juni ab und ist bis heute so geblieben. Die Fallzahlen auf der Grundlage von Tests steigen und schwanken jedoch wild nach oben und unten.
Die Medienberichterstattung in den USA schürt bereits die Erwartung einer zweiten Welle“.
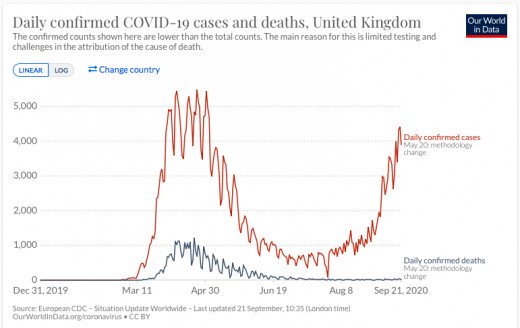
[Quelle: https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-deaths?time=2020-01-01..latest&country=~GBR]
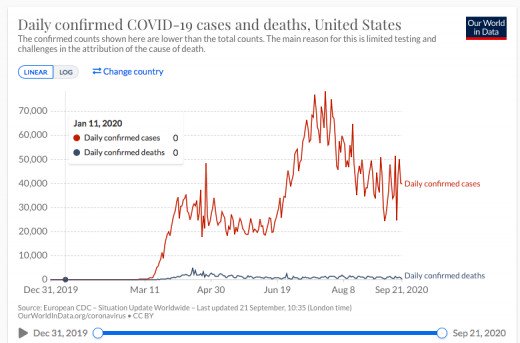
[Quelle: https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-deaths?time=2020-01-01..latest&country=~USA]
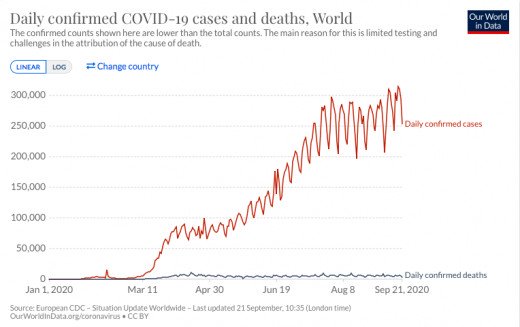
[Quelle: https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-deaths?time=2020-01-01..latest]
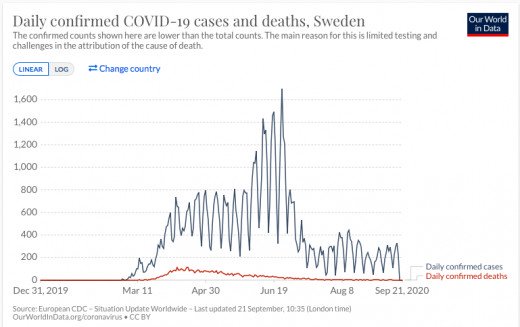
[Quelle: https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-deaths?time=2020-01-01..latest&country=~SWE]
Die Überlebensrate von COVID wird jetzt auf 99,8% geschätzt, ähnlich wie bei Grippe; bereits vorher vorhandene T-Zellen-Immunität
Die Überlebensrate von COVID-19 wurde seit Mai auf 99,8% der Infektionen nach oben korrigiert. Dies kommt einer gewöhnlichen Grippe nahe, deren Überlebensrate bei 99,9% liegt. Auch wenn COVID in der Tat schwerwiegende Nachwirkungen haben kann, kann eine Grippe oder jede andere Atemwegserkrankung ebenfalls schwerwiegende Folgen haben. Die derzeitige Überlebensrate ist weit höher als die von Dr. Anthony Fauci im März und April angeführten düsteren Schätzungen von 94%, was 20 bis 30 Mal tödlicher gewesen wäre. Der von Yeadon et al. in der Studie akzeptierte Wert für die Infektionsterblichkeitsrate (IFR) liegt bei 0,26%. Die Überlebensrate einer Krankheit beträgt 100% abzüglich der IFR.
Dr. Yeadon wies darauf hin, dass die „neuartige“ COVID-19-Ansteckung nur insofern neu ist, als es sich um einen neuen Typ des Coronavirus handelt. Er sagte aber, es gebe derzeit vier Stämme, die frei in der Bevölkerung zirkulieren und am häufigsten mit einer normalen Erkältung in Verbindung zu bringen seien.
In der wissenschaftlichen Studie schreiben Yeadon et al:
„Es gibt mindestens vier gut charakterisierte Familienmitglieder (229E, NL63, OC43 und HKU1), die endemisch sind und einige der üblichen Erkältungen verursachen, die wir vor allem im Winter erleben. Sie alle weisen auffällige Sequenzähnlichkeiten mit dem neuen Coronavirus auf.
Die Wissenschaftler machen geltend, dass ein Großteil der Bevölkerung bereits ein gewisses Maß an „T-Zellen“-Immunität gegenüber anderen verwandten Coronaviren, die schon lange vor COVID-19 zirkulierten, wenn nicht sogar Antikörper gegen COVID besitzt.
Die Wissenschaftler stellen fest:
„Ein Hauptbestandteil unseres Immunsystems ist die Gruppe der weißen Blutkörperchen, die sogenannten T-Zellen, deren Aufgabe es ist, sich ein kurzes Stück des Virus, mit dem wir infiziert wurden, zu merken, damit sich die richtigen Zelltypen schnell vermehren und uns schützen können, falls wir eine verwandte Infektion bekommen. Reaktionen auf COVID-19 haben sich in Dutzenden von Blutproben gezeigt, die von Spendern entnommen wurden, bevor das neue Virus kam.“
Die Autoren von „How Likely is a Second Wave?” („Wie wahrscheinlich ist eine zweite Welle?“) entwickeln den Gedanken, dass bereits eine gewisse frühere Immunität gegen COVID-19 bestand:
„Es steht jetzt fest, dass mindestens 30% unserer Bevölkerung dieses neue Virus bereits immunologisch erkannt hatten, bevor es überhaupt da war… COVID-19 ist neu, Coronaviren aber nicht.“
Sie führen weiter aus, dass aufgrund dieser früheren Resistenz nur 15-25% einer infizierten Bevölkerung ausreichen könnten, um die Herdenimmunität zu erreichen:
„…epidemiologische Studien zeigen, dass bei dem Ausmaß an vorhandener Immunität, das wir heute realistischerweise annehmen können, nur 15-25% der infizierten Bevölkerung ausreichen, um die Ausbreitung des Virus zum Stillstand zu bringen…“.
In den USA würde dies bei einer angenommenen Anzahl von 200.000 Todesopfern und einer Infektionsterblichkeitsrate (infection fatality rate) von 99,8% bedeuten, dass auf jeden Verstorbenen etwa 400 Menschen kommen würden, die infiziert wurden und noch leben. Das entspräche etwa 80 Millionen Amerikanern oder 27% der Bevölkerung. Damit ist nach Auffassung von Yeadon und seinen Kollegen die Schwelle der Herdenimmunität erreicht.
Die Autoren führen aus:
„In der aktuellen Literatur wird festgestellt, dass zwischen 20% und 50% der Bevölkerung diese präpandemische T-Zell-Reaktionsfähigkeit aufweisen, was bedeutet, dass wir für den anfälligen Bevölkerungsanteil einen ursprünglichen Wert von 80% bis 50% annehmen könnten. Je geringer die tatsächliche anfängliche Anfälligkeit, desto sicherer trifft unsere Behauptung zu, dass eine Herdenimmunitätsschwelle (HIT) erreicht ist.

Impressum für „Lockdown Skeptics.org“, Herausgeber des Buches „How Likely is a Second Wave?“ | Quelle
Die falsch positive zweite Welle
Über den PCR-Test, den weltweit verbreiteten COVID-Test, schreiben die Autoren:
„Mehr als die Hälfte der positiven Ergebnisse sind wahrscheinlich falsch, möglicherweise alle.“
Die Autoren erläutern, dass das, was der PCR-Test tatsächlich misst, „einfach das Vorhandensein von partiellen RNA-Sequenzen im intakten Virus“ ist, bei denen es sich um ein Stück totes Virus handeln könnte, das den Probanden nicht krank machen, nicht übertragen werden und auch niemanden sonst krank machen kann.
„…ein echter Positivbefund zeigt nicht unbedingt das Vorhandensein eines lebensfähigen Virus an. In begrenzten Studien haben viele Forscher bisher gezeigt, dass einige Versuchspersonen noch lange nach dem Verschwinden der Fähigkeit, Viren aus Abstrichen zu kultivieren, PCR-positiv bleiben. Wir bezeichnen dies als „Kaltpositiv“ (zur Unterscheidung von einem „Heißpositiv“-Fall, d.h. einer Person, die tatsächlich mit einem intakten Virus infiziert ist). Der springende Punkt bei „kaltpositiven“ Probanden ist, dass sie nicht krank sind, keine Symptome zeigen und auch keine entwickeln und darüber hinaus nicht in der Lage sind, andere zu infizieren.“
Insgesamt entwickelt Dr. Yeadon die These, dass jede „zweite Welle“ von COVID und jeder staatliche Lockdown-Fall angesichts der bekannten Prinzipien der Epidemiologie als mutwillig konstruiert anzusehen sind.
Diesen Monat wurde in Boston die Durchführung von Coronavirus-Tests durch ein Labor ausgesetzt, nachdem 400 falsch positive Ergebnisse entdeckt worden waren.
In einer Analyse des PCR-basierten Tests auf der medizinischen Website medrxiv.org heißt es
„Daten über PCR-basierte Tests für ähnliche Viren zeigen, dass PCR-basierte Tests so viele falsch-positive Ergebnisse liefern, dass positive Ergebnisse in vielen realen Szenarien als höchst unzuverlässig anzusehen sind.
Professor Carl Heneghan, Direktor des Centre for Evidence-Based Medicine der Universität Oxford, schreibt in einem Artikel vom Juli unter dem Titel: „Wie viele COVID-Diagnosen sind falsch positiv?“ Folgendes:
„Wenn man von den derzeitigen Testpraktiken und -ergebnissen ausgeht, kann es sein, dass Covid-19 niemals nachweislich verschwindet.“
Das berühmteste Ereignis hinsichtlich der Unzuverlässigkeit von PCR-Tests war natürlich, als der Präsident von Tansania der Welt enthüllte, dass er heimlich Proben von einer Ziege, einem Schaf und einer Papaya-Frucht an ein COVID-Testlabor geschickt hatte. Sie kamen alle COVID-positiv zurück.
Made in China
Im August entdeckte die schwedische Regierung 3700 falsche COVID-Positivbefunde, die mit Testkits der chinesischen Firma BGI Genomics erzielt wurden. Die Kits wurden im März von der FDA zur Verwendung in den USA zugelassen.
Zweite Wellen von Coronaviren nicht normal
Dr. Yeadon stellte die Vorstellung in Frage, dass sich alle Pandemien in aufeinanderfolgenden Wellen ereignen, und verwies auf zwei weitere Ausbrüche des Coronavirus, das SARS-Virus im Jahr 2003 und das MERS im Jahr 2012. Was wie zwei Wellen erscheinen mag, können in Wirklichkeit zwei einzelne Wellen sein, die in verschiedenen geografischen Regionen auftreten. Die Autoren sagen, dass die Daten, die bei den relativ neuen Ausbrüchen von SARS 2003 und MERS gesammelt wurden, ihre These untermauern.
Im Fall von MERS:
„…handelt es sich in Wirklichkeit um mehrere Einzelwellen, die geografisch unterschiedliche Bevölkerungen zu verschiedenen Zeiten während der Ausbreitung der Krankheit betrafen. In diesem Fall wurde der erste große Höhepunkt in Saudi-Arabien und ein zweiter Höhepunkt einige Monate später in Südkorea beobachtet. Bei individueller Analyse folgte jedes Gebiet dem Muster eines typischen Einzelereignisses…“.
Auf die Frage nach der Spanischen Grippeepidemie von 1918, die während des Ersten Weltkrieges in aufeinander folgenden Wellen auftrat, wies Yeadon in dem Interview darauf hin, dass es sich um eine ganz andere Art von Virus handele, die nicht zur Familie der Coronaviren gehöre. Andere haben die allgemeine Unterernährung und unhygienische Zustände zu Beginn des Jahrhunderts verantwortlich gemacht. Die besonders schwer betroffenen Soldaten des Ersten Weltkriegs lebten in kaltem Schlamm und unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich für eine Immunresistenz vorstellen kann.
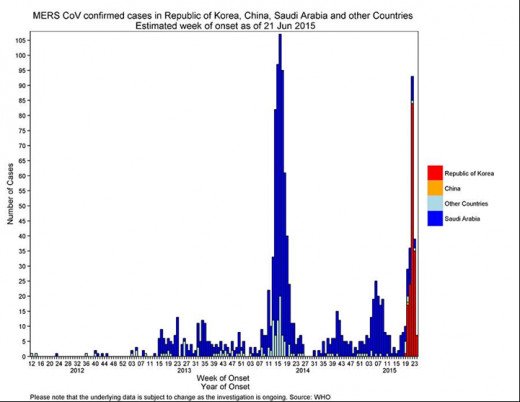
Wellen von MERS Coronavirus in Saudi-Arabien und Korea
Lockdowns funktionieren nicht
Ein weiteres Argument, das von Yeadon et al. in ihrer September-Publikation vorgebracht wird, lautet, dass die Ergebnisse keine Unterschiede im Zusammenhang mit Lockdowns aufweisen.
Sie sagen:
„Die Form der Kurve der Todesfälle im Zeitverlauf impliziert einen natürlichen Prozess und nicht einen, der hauptsächlich auf menschliche Eingriffe zurückzuführen ist …Bekanntlich hat Schweden beinahe eine Laissez-faire-Strategie angewandt, bei der qualifizierte Ratschläge erteilt, aber keine allgemeinen Lockdowns durchgeführt werden. Dennoch ist das Profil Schwedens und Großbritanniens sehr ähnlich.“
Der wohlerzogene Yeadon demontiert den Mann, der alles ins Rollen brachte: Professor Neil Ferguson
Der ehemalige Pfizer-Vorstandsmitglied und Wissenschaftler stellt einen ehemaligen Kollegen Professor Neil Ferguson in vernichtender Weise an den Pranger. Ferguson unterrichtete am Imperial College, während Yeadon Mitglied war. Fergusons Computermodell lieferte den Regierungen die Begründung für die Einführung drakonischer Verordnungen, die freie Gesellschaften über Nacht in virtuelle Gefängnisse verwandelten. Und das wegen eines Virus, für das das CDC jetzt eine Überlebensrate von 99,8% schätzt.
Dr. Yeadon sagte in dem Interview, dass „kein seriöser Wissenschaftler dem Modell von Ferguson irgendeine Gültigkeit zuspricht“.
Mit kaum verhohlener Verachtung für Ferguson gab sich Dr. Yeadon besondere Mühe, seinen Interviewer auf Folgendes hinzuweisen:
„Es ist wichtig, dass Sie wissen, dass die meisten Wissenschaftler nicht akzeptieren, dass es [Fergusons Modell] auch nur annähernd richtig war… aber die Regierung ist immer noch mit dem Modell verheiratet.“
Yeadon schließt sich anderen Wissenschaftlern an, die Regierungen dafür anprangern, dass sie dem Ferguson-Modell folgen, auf dessen Annahmen alle weltweiten Lockdowns basieren. Einer dieser Wissenschaftler ist Dr. Johan Giesecke, ehemaliger leitender Wissenschaftler des European Center for Disease Control and Prevention, der das Ferguson-Modell als „die einflussreichste wissenschaftliche Arbeit“ der Geschichte – und als „eine der falschesten“ bezeichnet.
Es war Fergusons Modell, das „eindämmende“ Maßnahmen postulierte, d.h. soziale Distanzierung und Unternehmensschließungen, um z.B. zu verhindern, dass über 2,2 Millionen Menschen in den USA an COVID sterben.
Ferguson prophezeite, dass Schweden einen schrecklichen Preis für den Verzicht auf den Lockdown zahlen würde: 40.000 COVID-Tote bis zum 1. Mai und 100.000 bis Juni. Die Zahl der Todesfälle in Schweden liegt aktuell bei 5800. Die schwedische Regierung erklärt, dass dies mit einer milden Grippesaison zusammenfällt. Obwohl Schwedens Pro-Kopf-Todesrate ursprünglich höher war als die der USA, ist sie jetzt niedriger, dies aber ohne den enormen wirtschaftlichen Schaden, der in den USA noch immer angerichtet wird. Schweden hat nie Restaurants, Bars, Sportstätten, die meisten Schulen oder Kinos geschlossen. Die Regierung hat den Menschen nie befohlen, Masken zu tragen.
Dr. Yeadon spricht mit Bitterkeit über die Menschenleben, die der Lockdown-Politik zum Opfer gefallen sind, und über die „rettbaren“ zahllosen Menschenleben, die durch wichtige Operationen und andere Gesundheitsfürsorgemaßnahmen, die aufgeschoben werden, wenn Lockdowns wieder eingeführt werden, weiter verloren gehen werden.
Yeadon ist ein erfolgreicher Unternehmer, der Gründer einer Biotech-Firma, die von Novartis, einem anderen Pharmariesen, übernommen wurde. Yeadons Einheit bei Pfizer war die Asthma and Respiratory Research Unit. (Yeadon, auszugsweise Liste der Veröffentlichungen).

Schweden während internationaler Lockdowns
Warum geschieht das alles? Ein US-Kongressabgeordneter sagt, er sei vom „Regierungsplan“ überzeugt, Lockdowns bis zu einem obligatorischen Impfstoff fortzusetzen. Alles nur Verschwörungstheorien?
Die Liste der Nachrichten wird immer länger, die die in den Mainstreammedien verbreitete Geschichte eines mysteriösen, „neuartigen“ Virus ins Wanken bringt, der nur durch einen beispiellosen Angriff auf die Rechte und Freiheiten des Einzelnen unter Kontrolle gebracht werden könne. Genau dieser Angriff droht nun erneut über die bereits leidende Bevölkerung hereinzubrechen, die keine andere Wahl hat, als sich weiteren Regierungsanordnungen zu unterwerfen.
Die Regierungen haben ihre Befugnisse stillschweigend auf unbestimmte Zeit ausgeweitet, indem sie die Zielmarke stillschweigend von „Abflachung der Kurve“ zur Entlastung der Krankenhäuser auf „keine neuen Fälle“ verschoben haben. Von „Pandemie“ zu „Falldemie“.
In Deutschland hat sich eine Organisation von 500 deutschen Ärzten und Wissenschaftlern gebildet, die der Meinung sind, dass die Reaktion der Regierung auf das COVID-Virus in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Schweregrad der Krankheit steht.
Die Beweise für Schikanen nehmen zu. Sowohl das CDC als auch die US Coronavirus Task Force unter der Leitung von Dr. Deborah Birx sind der Meinung, dass die Definition des Begriffs „Tod durch COVID“ dehnbar ist und die Regeln die Klassifizierung als COVID begünstigen, wo immer dies möglich ist. Dies eröffnet die Chance, eine stark aufgeblähte Zahl von Todesfällen bekanntzugeben. In New York wird gegen die Regierung von Gouverneur Andrew Cuomo durch Bundesbehörden ermittelt, weil sie die Todesurteile für Tausende von älteren Menschen in Pflegeheimen unterschrieben hat, als der Staat COVID-Patienten in die Pflegeheime schickte und sich damit über die händeringend vorgebrachten Einwände der Führungskräfte und Mitarbeiter der Pflegeeinrichtungen hinwegsetzte.
Warum ignorieren die großen Medien etwas, was ein eminent berichtenswertes Thema zu sein scheint – einen Branchen-Rockstar wie Yeadon, der die größten Akteure in der Welt des öffentlichen Gesundheitswesens herausfordert? Sollten die Sonntags-Talkshows, die Chris Wallaces und Meet the Press, einem solchen Mann nicht für ein Rekordpublikum auf den Zahn fühlen wollen?
Hier könnte sich die Debatte auf düstere Agenden verlagern, und nicht nur auf bloße Inkompetenz, Stumpfsinn und Dummheit.
Eine Meinung wurde vom US-Repräsentanten Thomas Massie (R-KY) geäußert, als er am 16. August in der Tom Woods Show sagte:
„Das Geheimnis, das die Regierung vor Ihnen verbirgt, ist, dass sie vorhat, uns so lange einzusperren, bis es eine Art Impfstoff gibt, und diesen dann auf Bundesebene oder auf der Ebene der Bundesstaaten obligatorisch einzuführen, oder vielleicht die Arbeitgeber durch ein neues PPP-Programm zu überzeugen, für das Sie sich nicht qualifizieren können, wenn Sie Ihre Angestellten nicht dazu bringen, sich impfen zu lassen – ich denke, das ist ihr Plan. Jemand kann mich gern davon überzeugen, dass das nicht ihr Plan ist, aber es gibt kein anderes logisches Ziel als dieses.“
Eine andere Theorie besagt, dass die COVID-Krise dazu benutzt wird, noch nie dagewesene Formen der Kontrolle über Individuen und Gesellschaft durch Eliten zu erzielen und zu konsolidieren. Dies wird vom Neffen des ermordeten Präsidenten Kennedy, Robert F., Kennedy Jr., Sohn des ebenfalls ermordeten Bobby Kennedy, vorgebracht. In einer Rede auf einer massiven Anti-Lockdown-Kundgebung gegen COVID-Impfungen in Deutschland warnte Bobby Jr. vor der Existenz
„einer Biosicherheits-Agenda, dem Aufstieg des autoritären Überwachungsstaates und dem von Big Pharma gesponserten Staatsstreich gegen die liberale Demokratie… Die Pandemie ist eine Gefälligkeitskrise für die Elite, die diese Politik diktiert“, warnte Bobby Jr..
In einer Klage warnen die medizinischen Sachverständigen von Kennedy Jr. davor, dass die obligatorische Grippeimpfung viele Kinder anfälliger für COVID macht.
Die Warnungen vor den düsteren Absichten von Kennedys „Elite“ kommen immer mehr auch aus Mainstream-Quellen. Dr. Joseph Marcela von der hoch angesehenen medizinischen und häufig aufgerufenen Informationsseite Mercola.com hat eine sorgfältige Überprüfung der Behauptungen eines Arztes über genetisch veränderte Impfstoffe, die auf uns zukommen, gefordert.
Auch dass eine Website des Verteidigungs-Establishments, Defense One, berichtet, dass permanente Biochips unter der Haut, die mit derselben Spritze injiziert werden können, in der sich der Impfstoff befindet, bald von der FDA zugelassen werden könnten, ist kaum geeignet, Befürchtungen zu zerstreuen. Es hilft den Gegnern von Verschwörungstheorien auch nicht gerade, dass laut Newsweek Dr. Anthony Fauci dem Wuhan-Labor in der Tat NIH-Mittel für die Erforschung des Fledermaus-Coronavirus zur Verfügung gestellt hatte, die so gefährlich waren, dass sie von 200 Wissenschaftlern offiziell abgelehnt und in den USA verboten wurden.
1957 kam es zu einer Pandemie, der asiatischen H2N2-Grippe mit einer Infektionssterblichkeitsrate von 0,7%, an der in den USA pro Kopf so viele Menschen starben, wie jetzt von COVID behauptet wird. Damals gab es keine einzige Erwähnung in den Nachrichten, ganz abgesehen von den außerordentlichen Umwälzungen, die wir heute erleben. Im Jahr 1968 traf die Hongkong-Grippe die USA (0,5% IFR,) und raffte 100.000 Menschen dahin – zu einer Zeit, da die USA eine deutlich niedrigere Bevölkerungszahl hatten. Nicht ein einziger Alarm wurde ausgelöst, nicht ein einziges Geschäft geschlossen und nicht einmal eine Meldung in den Nachrichten verbreitet. Im darauf folgenden Sommer fand mit Woodstock die größte Massenversammlung in der Geschichte der USA statt.
Massenhysterie ist nie zufällig, sondern kommt jemandem zugute. Die einzige Frage, die es noch zu beantworten gilt, lautet: Wem?
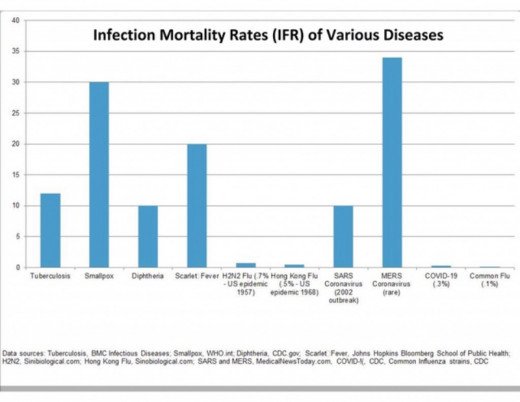
Copyright © Ralph Lopez, HubPages, 2020
[Anm. des Übersetzers: Ich habe den Artikel nach bestem Wissen und Gewissen übersetzt, um den Leser über seinen Inhalt zu informieren. Im Zweifel ist allerdings stets der englische Originaltext entscheidend.]
Die Gretas

[Dieser Artikel erscheint in meiner Kolumne in der aktuellen Ausgabe des Deutschen Nachrichtenmagazins ZUERST! Aus gegebenem Anlass veröffentliche ich ihn mit freundlicher Genehmigung der Chefredaktion auch hier.]
Seit Monaten wird die erst sechzehnjährige Schwedin Greta Thunberg als „Klima-Aktivistin“ von einem etablierten Massenmedium zum anderen weitergereicht. Sie ist nicht das erste junge Mädchen, das als Gesicht für derlei Kampagnen herhalten darf – denken wir an die achtzehnjährige Emma Gonzalez aus Florida, die im vergangenen Jahr wegen ihrer „Wutrede“ gegen die Waffenlobby zum Star aufgepumpt wurde.
Offenbar verspricht das Establishment sich etwas davon, junge Menschen, vor allem Mädchen, für seine Propaganda zu missbrauchen und seinen eigenen Anliegen dadurch das Image des „Idealistischen“, „Authentischen“ und „Rebellischen“ aufzukleben. Es scheint unter den Entscheidungsträgern niemandem in den Sinn zu kommen, dass allein der offenkundige Kampagnencharakter dieser Art von Präsentation mindestens zwei der drei Ansprüche dementiert:
Mag der Idealismus der Gretas und Emmas zumindest subjektiv auch aufrichtig sein – ihre Naivität ist durchaus altersgerecht –, so entspricht ihre „Authentizität“ in etwa der einer von kommerziellen Musikproduzenten zusammengestellten Girlgroup, und dies gleich in doppelter Hinsicht: erstens, weil das Establishment – und sonst niemand – darüber entscheidet, wer hochgejubelt wird und wer nicht, zweitens, weil sowohl der sogenannte Klimaschutz als auch die amerikanische Waffengesetzgebung keine authentischen Aufreger sind. Es handelt sich vielmehr um Themen, die von den Medien des Establishments massiv und systematisch propagiert werden mussten, um ihren Weg in die Köpfe der Gretas und Emmas zu finden, die nun von denselben Medien als Verstärker benutzt werden. Was schließlich den Aspekt der „Rebellion“ angeht, so würde eine wirkliche Rebellin niemals das Wohlwollen des Establishments und schon gar nicht die geballte Unterstützung seiner Medien genießen.
Dass gerade eine solche Propagandastrategie überhaupt mit Aussicht auf Wirkung verfolgt werden kann, sagt über die politische Reife des anvisierten Publikums nichts Gutes aus. Offenbar rechnen die Verantwortlichen nicht mit der Frage, was ausgerechnet Halbwüchsige dazu qualifizieren soll, als politische und moralische Autoritäten aufzutreten? Wann sie die Zeit gefunden haben sollen, sich mit den entsprechenden Themen so fundiert zu befassen, wie es erforderlich wäre, um die ihnen zuteilwerdende Medienaufmerksamkeit zu rechtfertigen? Ob ihnen klar ist, dass das bloß gut Gemeinte und das wirklich Gute in der Regel zwei verschiedene Dinge sind?
Die öffentliche Belobigung der Emmas, der Gretas und ihrer Nachahmer ist pures Gift – nicht nur für die Gesellschaft, sondern vor allem für die Betroffenen selbst und für die Millionen junger Menschen, denen sie als Vorbilder präsentiert werden.
Warum sagt ihnen keiner, dass Weltverbesserei selbst dann kein Weg zu einem gelungenen Leben wäre, wenn sie ausnahmsweise wirklich zur Verbesserung der Welt führte? (Was sie aber in der Regel nicht tut, weil sie regelmäßig darauf hinausläuft, Mitmenschen zu einer Lebensweise zu zwingen, die sie sich selbst nicht ausgesucht hätten. Also zum Diktatorverhalten.)
Zweifellos wollen sie gute Menschen sein. Warum verschweigt man ihnen, dass man dies nur dadurch werden kann, dass man mit sich selbst ringt, nicht aber dadurch, dass man diese oder jene politische Meinung hat und schon gar nicht dadurch, dass man deren Gegner verteufelt?
Und wenn man den Hang zur Weltverbesserung schon für etwas Gutes hält: Sollte man ihnen nicht sagen, dass die Verbesserung der Welt mindestens richtige Erkenntnis voraussetzt, diese aber nur um den Preis mühsamer Lernprozesse zu haben ist und es zu dieser Mühe nicht die kleinste Alternative gibt, schon gar nicht in Gestalt moralischer Phrasendrescherei? Dass Rebellion oder auch nur die vielzitierte „Zivilcourage“ etwas ist, wofür man nicht belobigt wird, sondern was einen Preis kostet, und dass man misstrauisch werden sollte, wenn man von den Medien unisono hofiert wird?
Man verschweigt ihnen all das aus einem objektiven und einem subjektiven Grund: Der objektive lautet, dass nichts den Machthabern so zupass kommt wie eine schein-authentische, scheinkritische Scheinrebellion auf der Basis einer Scheinmoral. Der subjektive Grund ist, dass die meisten Journalisten gerade darin und in all den Gretas sich und ihre eigene Jugend wiedererkennen, zu der sie nie eine kritische Distanz gewonnen und seit der sie nichts Grundlegendes dazugelernt haben.
Es ist der Journalismus einer Generation, die nie erwachsen wurde. Sich mit vierzig, fünfzig oder gar sechzig Jahren einzugestehen, dass man seit seiner Jugend am Gängelband der Machthaber gegangen ist – wo man doch so „kritisch“ und „revolutionär“ sein wollte – das tut freilich weh. Da führt man lieber die nächste junge Generation auf den Leim und ins Verderben.
[Dieser Artikel erscheint in meiner Kolumne in der aktuellen Ausgabe des Deutschen Nachrichtenmagazins ZUERST! Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung der Chefredaktion.]
Österreich: Die Ach-und-Krach-Sieger pfeifen im Walde
Wenn wir ermessen wollen, wie sehr sich in diesem Jahr 2016 die politischen Kräfteverhältnisse verschoben haben, brauchen wir nur ein wenig zurückzudenken: Als der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer im April im ersten Wahlgang zur österreichischen Präsidentschaftswahl über ein Drittel der Stimmen erhielt, wurde dies zu Recht als Sensation und Rechtsruck gewertet. Heute schreibt Spiegel online „Servus Rechtsruck„, weil Hofer im zweiten Wahlgang nur (!) 48 % der Stimmen erhalten hat.
Vor wenigen Monaten glaubte das Establishment noch, alles im Griff zu haben und das Publikum nach Belieben manipulieren zu können. Heute ist man in diesen Kreisen schon froh, wenn man feststellen darf, dass „Rechtspopulisten“ überhaupt noch „besiegbar“ sind. Da sind die Ansprüche ja gewaltig gesunken.
Der gequälte Unterton dessen, was wie Jubel klingen soll, ist unüberhörbar: Der Sieg des „Rechtspopulisten“ konnte nur dadurch (und nur mit Ach und Krach) verhindert werden, dass alle anderen Parteien zusammen gegen die FPÖ aufmarschierten und die mit ihnen verbündete Medienmafia den Kandidaten der Opposition praktisch unisono verteufelte: Nachwahlbefragungen haben ergeben, dass die meisten Hofer-Wähler hinter dem Kandidaten und seinem Programm standen, während van der Bellen etwa die Hälfte seiner Stimmen Wählern verdankte, die nicht für ihn, sondern gegen Hofer stimmen wollten. Ein „Sieg“ aller gegen einen, ein „Sieg“, der dennoch nur durch die Negativstimmen verhetzter Angstwähler und nur unter Hängen und Würgen zustandekam – das sind so die „Erfolge“, aus denen die Kartellschreiber heute ihren schalen Nektar saugen müssen. Dementsprechend gepresst klingen ihre Stimmen, blechern ihre Phrasen, unglaubwürdig und gespielt ihre Genugtuung.
Niemand kann übersehen, wer im Aufwind ist und wer auf dem absteigenden Ast sitzt. Insofern besteht auf Seiten der Opposition nicht der geringste Anlass zur Enttäuschung. Sicher, an die positiven Überraschungen (Brexit, Trump-Wahl) hat man sich schon so gewöhnt, dass man geradezu überrascht ist, wenn man einmal nicht überrascht wird. Trotzdem sollte man einen Riesenerfolg wie Hofers 48 % nicht gering achten. Die Hofburg wird noch ein wenig länger belagert werden müssen, aber der Belagerungsring ist geschlossen, das Establishment in Österreich in seiner Bewegungsfreiheit noch stärker eingeschränkt als bisher schon. Und Wahlen stehen auch in anderen Ländern an – die größer sind als Österreich.
Der Jubel des Establishments und seiner Schreiber ist das sprichwörtliche Pfeifen in einem sehr tiefen Wald, aus dem sie nie wieder einen Ausweg finden werden.
Trumps Triumph – das Waterloo des Machtkartells
Noch nie hat es so viel Spaß gemacht, die Elaborate des etablierten Meinungskartells zu konsumieren wie in diesen Tagen, in denen es sein Waterloo erlebt und mitansehen muss, dass der Mann, den es in geschlossener Phalanx zu verhindern suchte, ins Weiße Haus einzieht.
„Wie konnte es nur so weit kommen?“, fragen sie sich, und wie üblich kratzen ihre Erklärungen bestenfalls an der Oberfläche, meist aber nicht einmal an dieser. Vielmehr demonstriert die Journaille – im Gleichklang mit der etablierten Politik – ihre pathologische Lernunfähigkeit durch „Erklärungen“, von denen die meisten zwischen Dummheit, Lüge und Wahnsinn oszillieren.
Da ergeht man sich in psychologisierenden Diffamierungen der Trump-Wähler (und natürlich ihrer europäischen Gesinnungsfreunde), die als schwachsinnige, hasserfüllte Verlierertypen karikiert werden, die aus völlig irrationalen Gründen einem gewissenlosen Demagogen auf den Leim gegangen seien. Nichts könnte falscher sein:
- Wer gegen TTIP ist, musste Trump wählen.
- Wer gegen die weitere Entmachtung demokratisch legitimierter Politik zu Gunsten supranationaler Strukturen ist, musste Trump wählen.
- Wer gegen Masseneinwanderung ist (weil er ihre Folgen zu spüren bekommt), musste Trump wählen.
- Wer gegen die weitere Eskalation des Konflikts mit Russland ist, musste Trump wählen.
- Wer gegen die systematische Destabilisierung islamischer Länder, etwa Syriens, ist, musste Trump wählen.
- Und wer gegen ein Establishment ist, das diesen seinen wahnwitzigen weltweiten Destabilisierungs- und Destruktionskurs gegen jede Kritik abschottet und daher zu einer Selbstkorrektur offensichtlich außerstande ist, musste erst recht Trump wählen.
Zu Trump gab es keine Alternative, weil das Establishment aus sich heraus keine hervorbrachte und vermutlich auch keine mehr hervorbringen wird. Welche seiner Versprechen Trump halten wird, konnte und kann bis jetzt niemand wissen, aber was man von Hillary Clinton zu erwarten hatte, wusste man genau: Sie war die Verkörperung all der Fehlentwicklungen, die der gesamten westlichen Zivilisation das Genick brechen werden, wenn man ihresgleichen nicht in den Arm fällt.
Dass Clinton als Verkörperung des Establishments möglicherweise die falsche Wahl war, so weit kommen auch die Mainstreamjournalisten bei ihrer Ursachenanalyse. Aus ihrer Feder bedeutet dies aber nur, dass die Demokraten einen „unbelasteten“ Kandidaten hätten präsentieren sollen, also einen, der noch in der Lage gewesen wäre, sich als Anti-Establishment-Kandidat zu präsentieren, ohne einer zu sein. Auf Deutsch: Für die Mainstreampresse lag der Fehler darin, dass man es versäumt hat, die Wähler erfolgreich hinters Licht zu führen.
Das Bemerkenswerte an der Wahl in den USA ist gerade nicht, dass die Wähler irrational entschieden hätten, sondern dass sie die Destruktivität des Establishments durchschaut, dessen unaufhörlich abgefeuerte Nebelkerzen ignoriert und mit einer geradezu trockenen Rationalität den Mann gewählt haben, der versprochen hat, ihre Interessen zu vertreten.
Hätte Trump sich ausschließlich auf die Wähler stützen müssen, die ihn seines polternden Auftretens wegen wählten, so hätte er nicht einmal die Vorwahlen überstanden. Seinen Sieg verdankt er denen, die ihn trotz dieses Auftretens gewählt haben, und zwar aus der völlig vernünftigen Überlegung heraus, lieber einen Präsidenten zu sehen, der bisweilen Machosprüche klopft, als eine Präsidentin, der man zutrauen muss, womöglich einen Atomkrieg mit Russland anzuzetteln. Wenn das nicht politische Reife ist – was dann?
Die Medien beiderseits des Atlantiks haben alles getan, um solche im engeren Sinne politischen Überlegungen, insbesondere die Frage nach Interessen, gar nicht erst zum Thema werden zu lassen und lediglich den Kandidaten zu verteufeln, indem sie seine Political Incorrectness aufs Korn nahmen. Damit sind sie der Trump-Kampagne gleich in doppelter Hinsicht ins offene Messer gelaufen:
Zum einen war der Versuch, die eigentlich relevanten politischen Themen von der Agenda zu verdrängen, so plump und durchsichtig, dass der an die Medien gerichtete Vorwurf, eine Lügenpresse zu sein, die die Menschen zu manipulieren und für dumm zu verkaufen versucht, wieder einmal schlagend bestätigt wurde.
Zum Anderen haben sie durch ihre ständigen Angriffe, bei denen es fast ausschließlich um seine Sprüche ging, Trumps ideologische Nonkonformität erst richtig in jedermanns Bewusstsein gehämmert. Ein politisierender Milliardär, der gegen das Establishment antritt, zu dem er selber gehört, ist per se nicht besonders glaubwürdig. Es war das Establishment selbst, das ihm durch seinen geifernden Hass diese Glaubwürdigkeit verschafft hat. In diesem Zusammenhang haben Trumps Sprüche allerdings doch eine Rolle gespielt: nicht, weil seine Wähler sie gut fanden, sondern weil das Establishment sie verabscheute und dies an sich schon ein Grund war, ihn zu wählen. Und auch diese Reaktion der Wähler ist alles andere als eine irrationale Trotzreaktion:
Wer, wie das gesamte Establishment, einschließlich dessen ideologieproduzierender Fraktion und vor allem der Medien, eine Politik betreibt, die sich offenkundig gegen die Interessen einer großen Mehrheit richtet, hat in einer Demokratie naturgemäß ein Problem. Er kann sie nicht durchhalten, sofern die Demokratie ihrer Selbstbeschreibung gemäß funktioniert, wonach sie ein System sei, das – nicht ohne Verzerrungen, aber im Großen und Ganzen eben doch – den Wählerwillen widerspiegele. Er muss vielmehr verhindern, dass sie dies tut. Er muss die Demokratie sabotieren. Er muss den freien Wettbewerb sowohl zwischen Medien als auch zwischen Parteien zu Gunsten kartellartiger Strukturen suspendieren und dafür sorgen, dass niemand zu den politischen und medialen Eliten zugelassen wird, der ihre Ideologie nicht teilt und die Interessen der Mehrheit vertritt. Political Correctness hat nichts mit dem Versuch zu tun, Minderheiten zu schützen, es sei denn in ihrer Eigenschaft als Rammbock gegen die Interessen der Mehrheit. Sie dient dazu, die ideologische Konformität der Eliten zu wahren und oppositionellen Sichtweisen und Interessen von vornherein die Artikulations- und Wirkungsmöglichkeiten zu verbauen. Sie ist eine Waffe, die sich gegen das Volk richtet, und genau dies hat das amerikanische Volk verstanden und die Konsequenzen gezogen. Auf diesen Effekt hat Trump gesetzt. Sein Kalkül war riskant, aber dank der unfreiwilligen Mithilfe der Medien erfolgreich.
Wer um drei Ecken denkt, könnte vielleicht glauben, Trump sei womöglich doch der Kandidat des Establishments und die Kampagne gegen ihn nur Teil einer besonders durchtriebenen Strategie gewesen, einen bloß scheinbar oppositionellen Politiker ins Weiße Haus zu bringen. Nun ist es gewiss möglich, dass Trump die Erwartungen der Rechten ebenso enttäuscht, wie Obama die der Linken enttäuscht hat. Dass die herrschenden Eliten einen solchen Effekt aber eingeplant haben könnten, dagegen spricht ihre Bestürzung und Überraschung, die mit zu vielen psychologischen Elementarfehlern einhergeht, um gespielt zu sein:
In der Politik verliert man bisweilen, aber jeder Anfänger weiß, dass man auf keinen Fall dulden darf, wie ein Verlierer auszusehen; indem das politisch-mediale Machtkartell gerade hier in Europa seine schrille Panik laut hinausschreit, potenziert es den psychologischen Auftrieb noch, den Trumps Sieg den oppositionellen Parteien Europas ohnehin schon gibt. Auch der lächerliche Auftritt Angela Merkels, die dem gewählten Präsidenten der USA allen Ernstes Bedingungen für eine Zusammenarbeit glaubte stellen zu können, kann nur auf einen völligen Nervenzusammenbruch zurückzuführen sein. (Man bedauert geradezu, kein Karikaturist zu sein: Es wäre reizvoll, Merkel als Spitzmaus zu zeichnen, die einem Weißkopfseeadler Bedingungen vorliest, unter denen sie eventuell darauf verzichtet, ihn, den Adler, aufzufressen…). Es setzt das Tüpfelchen aufs i, dass diese „Bedingungen“ überhaupt nichts mit den Interessen Deutschlands zu tun hatten, sondern ausschließlich im ideologischen Bereich lagen, also wiederum unterstrichen, wie sehr das Kartell auf ideologische Konformität angewiesen ist.
Ins Bild passt auch, dass den Kartellmedien die Peinlichkeit dieses Auftritts offenbar ebenso wenig bewusst war wie der Kanzlerin selbst. Die „Zeit“ – die für die BRD dieselbe Rolle spielt wie „Das Reich“ für das Dritte Reich, nämlich die Rolle eines ideologischen Zentralorgans für die gebildeten Schichten – die „Zeit“ also phantasierte „Europa“, also die EU, zur einzigen „großen Macht“ hoch, „die auf dieser Erde Demokratie und Vernunft verkörpern kann“; natürlich kommt dem Autor nicht in den Sinn, dass es weder Trump noch Le Pen oder die AfD gäbe, wenn das, was er für „Demokratie und Vernunft“ hält, irgendetwas mit Demokratie oder Vernunft zu tun hätte. Im selben Zusammenhang befördert er ausgerechnet Angela Merkel zum „mächtigsten Menschen auf der Erde, der weder autoritär ist noch einen an der Waffel hat“, obwohl sie gerade bewiesen hat, dass sie beide Eigenschaften zu einem ausgewachsenen Größenwahn zu kombinieren fähig ist. Und er erwartet von ihr ein „Erziehungskonzept“ – er schreibt wirklich „Erziehung“! – im Umgang mit dem amerikanischen Präsidenten. Man kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus.
Dieses irrlichternde Schwanken zwischen heller Panik und leerem Auftrumpfen gibt ganz nebenbei einen Einblick in die Geistesverfassung der Leute – Journalisten wie Politiker –, die sich immer noch für die berufenen Vordenker und Führungspersönlichkeiten der Gesellschaft halten. Sie sind nicht nur intellektuell unfähig, ein Ereignis, das in ihrer ideologischen Wahnwelt nicht vorgesehen ist, angemessen zu deuten und zu erklären, sie sind mit seiner Bewältigung auch psychisch völlig überfordert:
Konfrontiert mit einer Niederlage, die sie völlig zu Recht als ihre eigene ansehen, geben sie nicht nur zu, dass es so ist – was an sich bereits ein Fehler ist –, sondern fallen auch völlig aus der Rolle, verlieren jede Souveränität und fangen an, wirres Zeug zu faseln. Man merkt daran, wie wenig eigenes Format diese Leute haben, die ihre gesamte Karriere auf Konformität innerhalb etablierter Machtstrukturen aufgebaut haben, und deren vermeintliche „Siege“ ihnen viel zu leicht gemacht wurden, weil es in Wahrheit Siege eines gut verschanzten Machtkartells gegen versprengte Oppositionelle waren. Zu solchen Siegen gehört weder Geist noch Charakter, eher das Gegenteil. Format zeigt sich – wenn es sich denn zeigt – in der Niederlage. Niederlagen sind aber im Weltbild von Karrieristen nicht vorgesehen, sie glauben ja, sich durch ihre Anbiederung bei den Machteliten dagegen versichert zu haben.
Wenn besagter Autor der „Zeit“ nun vom „Kampf“ schreibt, den es zu führen gelte, so ist dies zwar durchaus als Drohung gemeint. Nur: Mit welchen Mitteln will einer kämpfen, der die Gesellschaft, in der er lebt, aufgrund ideologisch bedingter Lernunfähigkeit nicht versteht? Der deshalb nur schwadronieren kann, wo seine Gegner analysieren? Der mit seinen ideologischen Schlagworten nur diejenigen Menschen überzeugt, die seine Ideologie ohnehin teilen, aber gerade nicht die, um die er werben müsste? Der unter „Kampf“ versteht, Andersdenkenden die Artikulationsmöglichkeiten zu verbauen und sie aus der Gesellschaft auszugrenzen? Dem nicht klar ist, dass der Graben, den er und seinesgleichen auf diese Weise quer durch das Volk ziehen, ein Graben ist, der über kurz oder lang sie selbst aussperrt? Und dem genauso wenig klar ist, dass alle Mittel dieser Art längst ausgereizt sind und die etablierten Machtstrukturen daher auf die Dauer nur noch durch einen offenen Staatsstreich zu verteidigen wären – letzterer aber angesichts der bröckelnden Loyalität von Polizei und Armee und der massiven Präsenz von US-Truppen unter einem Oberbefehlshaber Trump eine zunehmend riskante Angelegenheit wäre.
Einen Konsens gibt es freilich zwischen Freund und Feind, nämlich dass mit diesem 9. November 2016 nichts mehr so ist, wie es vorher war. Gewiss spürt man als Oppositioneller schon seit rund zwei Jahren, dass die Tore, gegen die man immer wieder mit dem Rammbock angerannt ist, nachzugeben beginnen und ihre Stabilität mit jedem neuen Stoß geringer wird. Und doch bin ich sicher, dass die Wahl Trumps im Rückblick als Wasserscheide betrachtet werden wird.
War der Brexit noch eine Konzession, zu der das britische Establishment gezwungen war, die aber immerhin dafür gesorgt hat, dass es die Fäden weiterhin in der Hand hält, so hat der Sieg Trumps bewiesen, dass man dieses Kartell in offener Feldschlacht schlagen kann, weil ihm die Kontrolle über die Gesellschaft entgleitet. Und dieses Ergebnis ist, ganz unabhängig davon, was Trump tut oder lässt, nicht mehr aus der Welt zu schaffen.